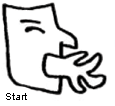


| Diskussionsforum | Archiv | Bücher & Aufsätze | Verschiedenes | Impressum |
Theodor Ickler
Wem gehört die deutsche Sprache?
Die sogenannte Rechtschreibreform ist auf der ganzen Linie gescheitert.
Sie ist aus sprachwissenschaftlicher Sicht schwer fehlerhaft und hätte sogar nach dem Urteil ihrer Urheber korrigiert werden müssen, bevor sie in Kraft trat. Daher unterzeichneten im April 1998 rund 600 Professoren der Sprach- und Literaturwissenschaften folgende Erklärung:
„Die sogenannte Rechtschreibreform 'entspricht nicht dem Stand sprachwissenschaftlicher Forschung' (so die Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft am 3. März 1998); sogar die Rechtschreibkommission der Kultusminister hat in ihrem Bericht vom Dezember 1997 wesentliche Korrekturen als „unumgänglich“ bezeichnet. Eine derart fehlerhafte Regelung, die von den bedeutendsten Autoren und der großen Mehrheit der Bevölkerung mit guten Gründen abgelehnt wird und die Einheit der Schriftsprache auf Jahrzehnte zerstören würde, darf keinesfalls für Schulen und Behörden verbindlich gemacht werden.“
Die Reform hat ihr Ziel, die Rechtschreibung besonders für Schüler zu erleichtern, nicht erreicht, sondern nachweisbar geradezu das Gegenteil bewirkt. Sie hat sogar nach Meinung des Kultusministers Zehetmair, der sie in Bayern besonders früh und unnachgiebig durchsetzte, nicht zu größerer Einheitlichkeit, sondern zu einem orthographischen Durcheinander geführt. (Stuttgarter Nachrichten 24.3.2001) Die Lehrer sind frühzeitig angewiesen worden, angesichts der vielen verschiedenen Wörterbücher immer zugunsten des Schülers zu entscheiden – was dazu führt, daß seit fünf Jahren vor allem inder Sekundarstufe kaum noch ernsthafter Rechtschreibunterricht stattfindet.
Vom Unwert dieser Reform kann sich jedermann täglich am Beispiel der Zeitungen überzeugen, obwohl darin nur ein Teil der neuen Regeln angewandt und der gröbste Unfug weitgehend vermieden wird. Nach einem Beschluß der Nachrichtenagenturen werden wesentliche Teile der Neuregelung überhaupt nicht übernommen, zum Beispiel die Kleinschreibung fester Begriffe wie Erste Hilfe, die Kleinschreibung der Anrede Du usw., die Eindeutschung von Fremdwörtern aus lebenden Sprachen, dazu die gesamte neue Zeichensetzung.
Die Bevölkerung lehnt die Reform weiterhin mit großer Mehrheit ab, ebenso haben fast alle namhaften Schriftsteller es untersagt, ihre Werke in der Neuschreibung zu drucken, auch auszugsweise in Schulbüchern.
Zur Zeit laufen, teilweise hinter verschlossenen Türen, Rückbaumaßnahmen, die sämtliche umgestellten Wörterbücher, Schulbücher, Kinderbücher und Rechtschreibprogramme sowie eine Unzahl von teuer bezahlten Nachschulungen bereits jetzt entwertet haben, aber auch die jüngst erschienenen, bereits durchgreifend revidierten Wörterbücher werden in Kürze durch die nächsten Schritte der Rechtschreibkommission überholt werden. Hinzu kommt die ungeheuer wichtige Rechtschreib-Software, die zur Zeit noch ganz wesentlich zu dem Eindruck beiträgt, die Reform sei akzeptiert, während in Wirklichkeit bloß die Voreinstellungen von Microsoft beibehalten werden – sei es aus Bequemlichkeit oder aus Unwissenheit.
Der volkswirtschaftliche Schaden ist enorm; es gibt auch Steuerausfälle. Kleinere Verlage gehen an den Umstellungskosten und an der allgemeinen Verwirrung zugrunde oder werden von größeren aufgekauft.
Der Zerfall des ganzen Unternehmens zeigt sich auch darin, daß der kürzlich eingerichtete „Beirat für deutsche Rechtschreibung“, der die zwischenstaatliche Kommission vor weiteren Dummheiten bewahren soll, nur von deutscher Seite getragen wird. Zur ersten gemeinsamen Sitzung mit der Kommission am 8. Februar 2001 trat folglich auch nur deren deutsche Hälfte an; sie ist aber ohne die Österreicher und Schweizer gar nicht mehr arbeits- und beschlußfähig.
Bedenkt man, daß die Reform bereits Milliarden verschlungen und erhebliche immaterielle Schäden in den Köpfen der Menschen angerichtet sowie einen großen Teil des Buchbestandes in Mitleidenschaft gezogen hat, so stellt sich unabweisbar die Frage: Wie ist es zu dieser Ungeheuerlichkeit gekommen?
Im zwanzigsten Jahrhundert soll es ungefähr hundert Entwürfe einer Rechtschreibreform gegeben haben. Am weitesten gediehen war die Reform des Reichserziehungsministers Bernhard Rust. Nur die Verhältnisse gegen Ende des Zweiten Weltkrieges verhinderten die Umsetzung seiner Reform, die eine sehr große Ähnlichkeit mit der heutigen aufweist – ohne übrigens spezifisch nationalsozialistisch zu sein.
Nach dem Krieg wurden zum Teil von denselben Personen neue Pläne in Angriff genommen. Einer der Hauptantreiber der heutigen Reform, der inzwischen in den Ruhestand getretene nordrhein-westfälische Kultur-Staatssekretär Friedrich Besch, sagte 1995:
„Seit 1952 wird an der jetzigen Reform gearbeitet.“ (FR 30. 11. 95)
Demnach hätten die Vorarbeiten nicht weniger als 40 Jahre gedauert! Die lange Vorbereitungszeit wird auch als Qualitätsgarantie angeführt. Das ist nicht nur an sich schon abwegig, sondern aus einem handfesten Grund völlig falsch:
Im Jahre 1973 erhielten die Vorbereitungen einen mächtigen Anstoß durch den GEW-Kongreß „vernünftiger schreiben“. Zentraler Programmpunkt war die sogenannte „gemäßigte Kleinschreibung“. Im übrigen herrschte damals eine kulturrevolutionäre Stimmung, die sich unter anderem im Plan eines Zensurenboykotts niederschlug. Wie die Kulturtechnik Rechtschreiben damals eingeschätzt wurde, zeigt folgendes Zitat:
„Schlechte noten in rechtschreibung haben einen ähnlichen charakter wie z. b. schlechte schulnoten wegen epilepsie, chronischem husten oder grippe.“ (Drewitz/Reuter [Hg.]: vernünftiger schreiben. Frankfurt 1973, S. 62)
Zwanzig Jahre später legten die Reformer einen Entwurf vor, der 1993 bei einer Anhörung in Bonn erörtert und von den Kultusministerien in weiten Teilen zurückgewiesen wurde. Als die Reformer ein Jahr später in Wien zu einem Abschluß kommen mußten, hatten sie Hals über Kopf etwas ganz anderes ausgearbeitet, als sie jahrzehntelang geplant hatten. Die Hauptpunkte waren nämlich gewesen:
• Kleinschreibung der Substantive
• Tilgung der Dehnungszeichen
• Eindeutschung der Fremdwörter
• Einheitsschreibung das – auch für die Konjunktion
In allen vier Punkten mußten sie nun gerade das Gegenteil beschließen, denn auch die Fremdwortschreibung wurde bis auf minimale Eingriffe nicht verändert (Philosophie, Physik, Katastrophe, Theater, Apotheke – all dies bleibt ja erhalten).
Damit überhaupt irgend etwas passierte und das ganze Unternehmen nach seinen rund zehn internationalen Treffen nicht als völlig vergeblich dastünde, wurden verschiedene Einzelregeln beschlossen, die sich sehr bald als undurchdacht und verhängnisvoll herausstellten, so daß die Reformer selbst schon Ende 1997 – auch unter dem Eindruck der Kritik – zu der Einsicht kamen, Änderungen der Reform seien „unumgänglich notwendig“. Überraschenderweise lehnten jetzt aber die Kultusminister jede Korrektur kategorisch ab. Die Neuregelung trat 1998 mit allen Fehlern in Kraft.
Inzwischen war nämlich etwas geschehen, was die Reformer sich besonders klug ausgedacht hatten, was aber nun nach hinten losging. Nach den Erfahrungen mit gescheiterten Reformprojekten waren sie zu folgender Einsicht gelangt:
„Eine Änderung geltender Konventionen und Normen über den Schüler zu erreichen, ist zwar verlockend und wäre, wenn es gelänge, auch am erfolgversprechendsten, aber sie setzt an am schwächsten Glied in der Kette.“
So der führende Reformer Gerhard Augst im Jahre 1982. Die Skrupel verflogen sehr bald, und der Weg über die Geiselnahme an den wehrlosen Schüler wurde entschlossen eingeschlagen. Auch der Nestor der Reformbestrebungen, der Bonner Sprachwissenschaftler Leo Weisgerber – übrigens als Ahnenerbe-Keltologe unrühmlich bekannt, nach dem Kriege aber von großem Einfluß auf den Deutschunterricht – hatte in den sechziger Jahren geschrieben, man müsse
„neue Formen der Willensbildung suchen (...) Zum mindesten muß zur Verwirklichung von Vorschlägen die Unterstützung durch Behörden in Anspruch genommen werden, die für Schule und amtlichen Gebrauch Anweisungen geben können.“ (Die Verantwortung für die Schrift. Mannheim 1964, S. 62)
Dies war inzwischen geschehen: Die Kultusminister hatten schon 1996 die Rechtschreibreform in die Schulen der meisten Bundesländer gedrückt. Die Wiener Absichtserklärung war von den deutschsprachigen Ländern am 1. Juli 1996 unterzeichnet worden. Schon einen Tag später lag das neue Wörterbuch von Bertelsmann in den Buchläden, und auch die ersten umgestellten Schulfibeln waren vorhanden. Daß es sich hier um ein abgekartetes Spiel handelte, kann man erkennen, wenn man sich die Vorgänge vom Sommer 1995 in Erinnerung ruft. Damals brachte Minister Zehetmair den bereits beschlossenen Reformentwurf zu Fall, weil ihm drei Dutzend Neuschreibungen (von mehreren tausend!) nicht gefielen, und eine bereits gedruckte Auflage des Duden mußte eingestampft werden – wodurch der Dudenverlag an den Rand des Ruins getrieben wurde. Ein Jahr später wurde die Reform trotz schwerer Bedenken unterzeichnet, nachdem eine anwesende Amtsperson gesagt hatte: „Bertelsmann hat schon gedruckt.“
Daß der Angriff auf den Duden – und zwar ein durchaus auch wirtschaftlich interessierter Angriff – ein Hauptmotiv der Reform war, plauderte der führende österreichische Reformer Karl Blüml aus:
„Das Ziel der Reform waren aber gar nicht die Neuerungen. Das Ziel war, die Rechtschreibregelung aus der Kompetenz eines deutschen Privatverlages in die staatliche Kompetenz zurückzuholen.“ (Standard 31. 1. 1998)
Von dieser Änderung sollte vor allem der Bertelsmannkonzern profitieren, der auf seiner Internetseite stolz verkündet:
„In der Folge (der Rechtschreibreform) wird Bertelsmann neben Duden der zweite deutsche Wörterbuchverlag.“
Ich erinnere auch daran, daß der Langenscheidt-Konzern, zu dem Brockhaus und Duden gehören, zur Zeit in einer schweren Krise steckt und der Brockhaus-Direktvertrieb bereits an Bertelsmann verkauft werden mußte.
Das Vorpreschen der Schulen hatte den Zweck, vollendete Tatsachen zu schaffen. Als Prof. Horst H. Munske im Zorn aus der Rechtschreibkommission austrat, sprach er im SPIEGEL von einer "Überrumpelungsaktion“. Damit meinte er vor allem die Umdeutung der Erprobungsphase zur endgültigen Einführung. Von der versprochenen Erprobung konnte in der Tat keine Rede sein, denn seit 1996 wurde an der mißratenen Neuregelung kein Jota geändert, jedenfalls nicht offiziell.
Der Hinweis, man dürfe nun die Schüler mit ihrer Neuschreibung nicht allein lassen, war fortan das stärkste Argument, mit dem alle sachlichen Bedenken beiseitegewischt wurden. In Schleswig-Holstein wurde ein erfolgreicher Volksentscheid gegen die Reform mit dem Argument gekippt, die Schüler sollten nicht auf einer Rechtschreibinsel leben. (In Wirklichkeit sitzen heute alle Schüler auf einer solchen Insel, denn außerhalb der Schule schreibt niemand so wie sie.) Übrigens hatte sich der Staat in Schleswig-Holstein in übler Weise zum Komplizen der Schulbuchverleger und des Bertelsmannkonzerns gemacht, indem er durch allerlei Tricks den Volksentscheid erst zu verhindern und dann zu verfälschen versuchte. Zwar stürzte die Kultusministerin Böhrk darüber, aber das Ziel, die orthographische Gleichschaltung im Dienste der Verlagsinteressen, wurde dennoch erreicht.
Der Vorsitzende der Rechtschreibkommission stellt mit Befriedigung fest:
„Die Schule macht den Vorreiter.“ (Pressekonferenz in Mannheim am 12. 9. 1997)
Mit diesem Vorgehen vergleiche man, was der liberale Abgeordnete Heinrich Stephani 1880 im Deutschen Reichstag sagte:
„Die Schule soll den Schülern das, was in den gebildeten Kreisen des Volkes zur festen Gewohnheit in Bezug auf Rechtschreibung geworden ist, als Regel beibringen; nicht aber soll die Schule selbst vorangehen, indem die Schulen das Volk zwingen wollen, eine neue Gewohnheit der Rechtschreibung anzunehmen.“
Dieser selbstverständliche Grundsatz ist heute auf den Kopf gestellt. Das Bundesinnenministerium hat sich in diesem Punkt dem Grünen-Abgeordneten Volker Beck angeschlossen, der im Rechtsausschuß des Bundestages sagte, die staatlichen Dienststellen dürften keine andere Rechtschreibung haben als die Schule.
Im Rechtsausschuß hatte ich Gelegenheit, die Bedenken gegen die Reform vorzutragen. Einige Zeit später, am 24. 2. 1998, rief mich der Obmann der SPD in diesem Rechtsausschuß, Peter Enders, abends an und versuchte fast eine Stunde lang, mich von meinem Widerstand gegen die Rechtschreibreform abzubringen. Treibende Kraft sei das Bundesinneministerium. Er selbst nannte die Reform „Scheiße“ und machte mir klar, daß es ihm einzig und allein um die Vermeidung von Gesichtsverlust für die Kultusminister seiner Partei gehe; deshalb werde er im Bundestagsplenum dafür stimmen. So geschah es.
Daß die Politiker die Rechtschreibreform als Testfall für die Regierbarkeit des deutschen Volk ansahen, geht aus mehreren Quellen hervor:
Die österreichische Zeitung „Die Presse“ – übrigens die einzige, die ihre Leser befragte und daher bei der alten Rechtschreibung blieb – fragte den bayerischen Ministerpräsidenten Stoiber:
„Können Sie noch nachvollziehen und der Bevölkerung vermitteln, was mit der Rechtschreibreform los ist?“
Stoiber: „Die Reform ist sicher nicht mein Herzensanliegen. Es zeigt sich aber auch hier, daß die Leute immer weniger akzeptieren, was oben beschlossen wird. Und ich möchte vermeiden, daß genau so etwas wie mit der Rechtschreibreform auch mit dem Euro passiert!“ (Die Presse 5. 3. 1998)
Ähnlich äußerte sich Hans Joachim Meyer, der sächsische Kultusminister, im Deutschen Bundestag: die Rechtschreibreform sei ein Test für die Reformfähigkeit der Deutschen überhaupt.
Er konnte aber ebensowenig wie seine Gesinnungsgenossen verhindern, daß der Deutsche Bundestag am 26. 3. 1998 einen Beschluß faßte, in dem es heißt:
„Der Deutsche Bundestag ist der Überzeugung, daß sich die Sprache im Gebrauch durch die Bürgerinnen und Bürger, die täglich mit ihr und durch sie leben, ständig und behutsam, organisch und schließlich durch gemeinsame Übereinkunft weiterentwickelt. Mit einem Wort: Die Sprache gehört dem Volk.
(...)
Der Staat ist darauf beschränkt, Verfahren zur Feststellung der tatsächlich verwendeten Sprache festzulegen.“
Dann bittet der Bundestag um Überprüfung der Reform durch ein unabhängiges Gremium und fährt fort:
„Bis das Ergebnis dieser Überprüfung vorliegt, ist die hergebrachte Amtssprache des Bundes beizubehalten.“
Es gehört zu den betrüblichsten Tatsachen, daß sich die alte wie die neue Bundesregierung über diesen Plenumsbeschluß hinwegsetzten. Als ich dem neuen Bundestagspräsidenten Thierse meine Verwunderung über das Stillhalten des Parlaments angesichts dieser Brüskierung zum Ausdruck brachte, teilte er mir mit, mein Anliegen sie mit ähnlichlautenden an den Petitionsausschuß überwiesen worden. Von dort erfuhr ich später, daß man das Verfahren der Einführung ebenfalls nicht billige. Weiter geschah nichts, Bundesinnenministerium und Bundesjustizministerium führten die Neuschreibung in die Amtssprache ein, und zwar zum 1. 8. 1999. Daß dabei die überholte Fassung von 1996 zugrunde gelegt wurde, gehört zur Ironie der Geschichte.
Ich möchte hier einflechten, daß das Bundesinnenministerium tatsächlich eine ganz entscheidende Rolle spielte. Es hatte jahrzehntelang durch eine gewisse, in der Bertelsmann-Chronik nicht ohne Grund eigens erwähnte Ministerialrätin die Hand im Spiel, die heute mitsamt der angemaßten Rechtschreib-Zuständigkeit des Staates zum Kulturstaatsminister hinübergeschoben worden ist. Das ist auch der Grund, warum Minister Nida-Rümelin in dieser Sache überhaupt nichts tut.
Ein weiteres wichtiges Datum war das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 14. Juli 1998. Ich möchte etwas näher darauf eingehen, weil es die in Deutschland herrschende Auffassung von Sprache und Schrift besonders gut dokumentiert, aber auch wegen der außerordentlich merkwürdigen Umstände.
Am 12. Mai 1998 verhandelte das Bundesverfassungsgericht über die Beschwerde eines Lübecker Elternpaares gegen Beschlüsse des schleswig-holsteinischen Oberverwaltungsgerichts und des schleswig-holsteinischen Verwaltungsgerichts.
Schon einige Zeit vor der Verhandlung gab es aus verschiedenen Quellen Hinweise, daß das Urteil im Sinne der Kultusminister ausfallen werde. Bereits zwei Tage vor der mündlichen Verhandlung, zu der ich als Sachverständiger eingeladen war, teilte mir der damalige Vorsitzende der „Gesellschaft für deutsche Sprache“, Prof. Günther Pflug, triumphierend mit, er wisse aus zuverlässiger Quelle, daß das Bundesverfassungsgericht im Sinne der Kultusminister entscheiden werde. Jetzt seien nur noch die Volksbegehren zu fürchten. Dies hat sich mit überraschender Eindeutigkeit bestätigt, aber es bleibt doch merkwürdig, wie gut die Reformerseite über den Ausgang eines erst noch bevorstehenden Verfahrens informiert war. Ich bin damals trotz dieser trüben Aussichten nach Karlsruher gegangen, wo ich zusammen mit dem Präsidenten der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, Christian Meier, gegen rund fünfzig Experten der Reformerseite antrat, die vom Gericht in geradezu grotesker Überzahl eingeladen war.
Der wesentliche Inhalt des Urteils wurde etwa zehn Tage vor der Urteilsverkündung durch die Presse bekannt, und zwar unter Berufung auf Bonner Politiker. Daraufhin zogen die Beschwerdeführer ihre Beschwerde zurück, weil sie mit einem fairen Verfahren nicht mehr rechnen könnten. Das Bundesverfassungsgericht beschloß jedoch, „juristisches Neuland“ zu betreten (so die Pressestelle) und das Urteil dennoch zu verkünden, weil ein allgemeines Interesse daran bestehe.
Das Urteil läßt immer wieder durchblicken, daß sich das Gericht sprachliche Normen nur als von außen gesetzte Normen vorstellen kann. Damit wird das Wesen der Sprache von Grund auf verfehlt. Die Sprache ist ein typisches Gebilde der „unsichtbaren Hand“. Das bedeutet, die Menschen, die eine Sprache sprechen und weiterentwickeln, verfolgen keinen Gesamtplan, sondern wollen in jedem einzelnen Sprech- oder Schreibakt nichts weiter als größtmögliche Deutlichkeit. Gleichsam auf dem Rücken der einzelnen Sprechakte entwickelt sich das Sprachsystem weiter.
Man könnte hier gleich anknüpfen und sagen, daß die Reformerseite von einem grundsätzlichen Mißtrauen in die Selbstregulierungsfähigkeit der Sprachgemeinschaft ausgeht, also gewissermaßen der Marktwirtschaft mißtraut und lieber auf eine sprachliche Zentralverwaltungswirtschaft setzt, jedenfalls als notwendiges Korrektiv. Diese Auffassung ist von illiberalen, staatsautoritären Sprachwissenschaftlern wie dem ehemaligen Nationalsozialisten Weisgerber und dem heutigen führenden Reformer, dem SED-Professor Nerius (heute Mitglied der Rechtschreibkommission) fast gleichlautend vertreten worden.
Aufgrund dieser falschen Auffassung gelangt das Gericht zu der These, in der Sprache selbst könne es zu „korrekturbedürftigen Fehlentwicklungen“ kommen, die ein Eingreifen des Staates erforderlich machen. Man könnte sagen: Wie der Staat das Geld zur Verfügung stellt und über die Geldwertstabilität wacht, so stellt er nach Auffassung des Gerichts auch die einheitliche Sprache zur Verfügung und darf sie gegebenfalls auch verändern. Leider ist diese Auffassung in Deutschland weit verbreitet, und das ist ein Punkt, in dem etwa die Angelsachsen und Franzosen uns nicht verstehen – wie manche spöttischen Kommentare durchblicken lassen.
Ich möchte das Korrigieren der Sprachentwicklung durch den Staat an einem eher beiläufigen Fall veranschaulichen:
Zu den „korrekturbedürftigen Fehlentwicklungen“, die nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichtes den Staat auf den Plan rufen, gehört die Großschreibung der Anrede in Briefen und ähnlichen Texten. Die staatlich beauftragten Sachverständigen kamen nach jahrzehntelangen Vorarbeiten zu der bahnbrechenden Erkenntnis
„Duzt man jemanden, so besteht kein Anlaß, durch Großschreibung besondere Ehrerbietung zu bezeugen.“ (Duden-„Informationen“ vom Dezember 1994)
Und:
„Dieses Pronomen (du) drückt Vertrautheit aus, die Anwendung der Großschreibung für die distanziert-höfliche Anrede ist daher nicht angemessen.“ (Duden-Taschenbuch)
Ich will auf die abstrusen Einzelheiten nicht eingehen, sondern nur auf die ungeheuerliche Implikation dieser Behauptung hinweisen: Demnach hätten Generationen von Deutschen sich „nicht angemessen“ ausgedrückt, sie waren sozusagen aus Versehen oder Unwissenheit ehrerbietig oder höflich. Hier darf man zunächst fragen: Was geht das den Staat an? Es handelt sich ja eigentlich um gesellschaftliche Umgangsformen, und es ist eine kulturrevolutionäre Überhebung des Staates, in solche Verhältnisse gestaltend einzugreifen. Duz-Briefe sind Privatbriefe. Der Duden erwähnt herkömmlicherweise auch Grabinschriften: Die Erde möge Dir leicht sein [R 71]. Wie die Deutschen sind, werden sie wohl bald die Friedhofsordnungen ändern und die Kleinschreibung der Totenanrede zur Pflicht machen.
Um Einwände der Eltern abzuwehren, schreibt das Hessische Kultusministerium:
„Durch die Rechtschreibreform sind weder Grundrechte noch Elternrechte, noch andere Rechte berührt. (...) Welches Recht kann ernsthaft davon berührt sein, wenn in Briefentwürfen in der Schule die Anrede-Pronomina du, dein, dich usw. nicht mehr als fehlerhaft angestrichen werden, wenn sie klein geschrieben werden?“ (Standardbrief vom September 1997)
Im Brief an die Oma darf der kleine Fritz also weiterhin groß schreiben, nur im „Entwurf“ wird es ihm als Fehler angestrichen. Dabei soll doch die Schule auf das Leben vorbereiten.
Die heutige Scheinblüte der Reformschreibung geht aber nicht nur auf die staatlich verfügte Umstellung der Schulen und Behörden zurück, sondern auch auf die Bereitschaft der Presse, sich die Neuregelung, wenn auch mehr oder weniger durch Hausorthographien abgemildert, zu eigen zu machen. Erst in jüngster Zeit ist es gelungen, die entscheidende Rolle der Deutschen Presse-Agentur aufzuklären.
Bereits im August 1996 verschickte der Chefredakteur der dpa, Wilm Herlyn, an alle Kunden, d. h. die Zeitungs- und Rundfunkredaktionen, einen Brief, mit dem zwar eine Meinungsbildung herbeigeführt werden sollte, die Unvermeidlichkeit der Umstellung jedoch schon dringend beschworen wurde:
„Unserer Ansicht nach ist eine Umstellung auf die neue Rechtschreibung letztlich unvermeidlich – vor allem, weil die nachwachsende Lesergeneration anderenfalls den Printmedien verlorengehen könnte.“
Der Fragebogen, der diesem Schreiben beilag, war fast ein Jahr lang unauffindbar, weil die dpa ihn nicht herausrücken wollte, aber vor einigen Wochen habe ich ihn dennoch bekommen und festgestellt, daß er ebenso tendenziös formuliert ist. Die Möglichkeit der Verweigerung – die damals in der Tat das Ende der Reform bedeutet hätte, denn gegen die Zeitungen kann man die Rechtschreibung nicht auf Dauer verändern – wurde las geradezu abwegig dargestellt. Nimmt man hinzu, daß damals noch fast nichts über den Inhalt der Neuregelung bekannt war, so ist es leicht nachvollziehbar, daß ein gewissr Teil derjenigen Kunden, die – bei geringer Rücklaufquote – überhaupt antworteten, sich für die Umstellung aussprach. Später stellten aber alle Redaktionen es so dar, als seien sie sehr überrascht worden und hätten sich dem Vorpreschen der Nachrichtenagenturen nicht entziehen können.
Der Vorstand der Axel Springer Verlag AG ließ mitteilen:
„Es war nicht so, daß die deutschsprachigen Zeitungen die Agenturen gezwungen haben, sich der Reform anzunehmen. Der Bundesverband der Deutschen Zeitungsverleger und die Agenturen haben gemeinsam den Beschluß gefaßt, 1999 die Rechtschreibreform einzuführen.“
Die Redaktion der „Hörzu“ schrieb:
„Die künstlerische Freiheit ist uns – den einzelnen Redaktionen – nicht erlaubt, da ein Beschluß der Zeitungs- und Zeitschriftenverleger, sich der Reform anzuschließen, besteht.“
Damit konfrontiert, stellte der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. jedoch fest:
„Der BDZV hat niemals einen Beschluß zur Rechtschreibreform gefaßt.“
Dennoch muß es eine konzertierte Aktion der Zeitungsverleger gegeben haben, denn die synchronisierte Umstellung zum 1. August 1999 kann kein Zufall gewesen sein.
Ich füge noch hinzu, daß die Vorlage der Nachrichtenagenturen, ausgearbeitet von dem dpa-Mitarbeiter Albrecht Nürnberger, schwer fehlerhaft ist und trotzdem bis heute auf der Internetseite der dpa steht.
Bei vielen Zeitungen herrscht der Glaube, die Reformschreibung sei heute oder in naher Zukunft für jedermann verbindlich:
„Dem Entschluß der Frankfurter Allgemeinen Zeitung können wir uns nicht anschließen, da uns das Ignorieren bestehender Rechtsnormen beim besten Willen und trotz des verlockenden Ergebnisses nicht als Königsweg erscheinen mag.“ (Wolfram Weimer, Chefredakteur der WELT, brieflich)
Der ADAC schrieb:
„Ab dem 31. 07. 2005 ist die neue Rechtschreibung Pflicht und die bisherige Schreibweise nicht mehr zulässig. Insofern haben selbstverständlich weder wir als motorwelt noch irgendeine andere Institution die rechtliche oder faktische Möglichkeit diese Reform rückgängig machen.“
(„Motorwelt“ ist die auflagenstärkste Zeitschrift in Deutschland.)
Als „Bild der Wissenschaft“ im Herbst 2001 auch noch auf die Reformschreibung umstellte und ich daraufhin mein Abonnement kündigte, schickte mir der Chefredakteur ebenso wie anderen unwilligen Lesern seinen Standardbrief, in dem es heißt:
„Wie Sie wissen, ist es verbindliche Regel, dass ab Sommer 2002 in Deutschland nach der neuen Rechtschreibung zu verfahren ist. Egal ob man eine solche Verordnung nun billigt oder nicht, man ist gehalten, sich danach zu richten. Schliesslich fahre ich ja auch nicht weiterhin mit 60 durch Tempo-30-Zonen, auch wenn mir diese Einschränkung unsinnig erscheint.“
Ich meine, es müßte einem deutschen Staatsbürger doch auch ohne nähere Kenntnis der Umstände klar sein, daß der Staat außerhalb seiner Zuständigkeit nicht auch noch die Sprache und Rechtschreibung vorschreiben kann. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem ansonsten katastrophalen Fehlurteil überflüssigerweise noch einmal festgestellt.
„Soweit dieser Regelung rechtliche Verbindlichkeit zukommt, ist diese auf den Bereich der Schulen beschränkt. Personen außerhalb dieses Bereichs sind rechtlich nicht gehalten, die neuen Rechtschreibregeln zu beachten und die reformierte Schreibung zu verwenden. Sie sind vielmehr frei, wie bisher zu schreiben.“
Diese ganze unerfreuliche Geschichte läßt nur ein Fazit zu:
Die Sprache gehört dem Volk. Das Elend der Deutschen besteht darin, daß allzu viele von ihnen glauben, sie gehöre dem Staat.
(Aus: IBW-Journal 4/2002, nach einem Vortrag im Rahmen der „4. Erlanger Kunststofftage“ am 27. September 2001)
Zu diesem Aufsatz gibt es noch keine Kommentare.
| Als Schutz gegen automatisch erzeugte Einträge ist die Kommentareingabe auf dieser Seite nicht möglich. Gehen Sie bitte statt dessen auf folgende Seite: |
| www.sprachforschung.org/index.php?show=aufsaetzeA&id=34 |
| Kopieren Sie dazu bitte diese Angabe in das Adressenfeld Ihres Browsers. (Daß Sie diese Adresse von Hand kopieren müssen, ist ein wichtiger Teil des Spamschutzes.) |