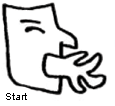


| Diskussionsforum | Archiv | Bücher & Aufsätze | Verschiedenes | Impressum |
Theodor Icklers Sprachtagebuch
23.03.2012
Vormachen und Nachmachen
Anthropologisches zur Sprache
Kulturelle Überlieferung bei Tieren muß kritischer gesehen werden.
Wenn die Sprache eine Kulturerscheinung ist, spielt die Frage nach ihrer Weitergabe eine entscheidende Rolle. Abgesehen von der selektiven Konditionierung spontaner Laute, die eher unwichtig sein dürfte, beruht der Spracherwerb auf Nachahmung und Vormachen. Dies wirft die Frage auf, wie weit Nachahmung und Vormachen schon bei Tieren anzutreffen sind.
Auffälligerweise läßt sich Nachahmung bei Tieren selten beobachten. Bekannte Fälle wie das Kartoffelwaschen japanischer Makaken, das Öffnen von Milchflaschen durch britische Meisen und das Nüsseknacken von Schimpansen lassen sich womöglich anders erklären. Tomasello und andere Forscher haben dafür den Begriff „Emulation“ eingeführt. Jedes Tier würde demnach die Fertigkeit unabhängig durch Versuch und Irrtum lernen, lediglich angeregt durch die von den Gruppenmitgliedern erzeugte Situation.
Beobachtet man das Verhalten freilebender Schimpansen, ist man von der Geschicklichkeit der älteren ebenso beeindruckt wie von der „Lernunwilligkeit“ der jungen. (Ausgezeichnete Filme sieht man im Internet.) Zwar machen sie sich gelegentlich mit den ohnehin bereitliegenden Nüssen und Steinen zu schaffen, aber es dauert Jahre, bis sie das Nüsseknacken selbst beherrschen. Wir erwarten eigentlich ein Hinschauen und Nachahmen, aber das geschieht nicht. Daß die Jungtiere überhaupt nachgeahmt haben, wird post festum aus der Tatsache geschlossen, daß sie es schließlich ebenfalls können, während in benachbarten Horden der gleichen Art die „Kultur“ des Nüsseknackens nicht auftritt. Wirklich beobachtet hat man das Nachahmungslernen nicht.
Noch weniger ist ein Lehren oder Unterrichten der Jüngeren durch die Älteren zu beobachten. Boesch und Tomasello (MPI Leipzig) definieren das Unterrichten sehr großzügig:
If teaching is defined very broadly to include any behavior of one animal that serves to assist another animal's learning, teaching is relatively common in the animal kingdom (Caro and Hauser 1992). But flexible and insightful forms of instruction in which one individual intends that another acquire a skill or piece of knowledge and adjusts its behavior contingent on the learner's progress in skill or knowledge would seem to be very rare. Adopting this intentional definition of teaching, Boesch (1991) observed a number of instances of teaching among Tai chimpanzees in the context of nut cracking. He divided his observations into "facilitation" and "active teaching." Observations of facilitation were fairly common and included such things as mothers' leaving intact nuts for their infants to crack (which they never did for other individuals) or placing hammers and nuts in the right position near the anvil for their infants to use. Active teaching was observed in only two instances, one in which a mother slowed down and modified her nut cracking and one in which a mother modified her son's positioning of the nut--in both cases as adjustments to the difficulties their offspring were having with the procedure. These instances of active teaching are very important because they seem to be of the type characteristic of all human cultures as they instruct their youngsters in at least some important cultural activities (Kruger and Tomasello 1996). This kind of instruction may be seen as a very powerful facilitator of social learning, since carefully crafted demonstrations would seem to frame and support developing youngsters' attempts at imitative learning. Facilitation would also seem to be important, as it exposes youngsters to novel learning experiences, but in this case the learning is left up to them. (http://cogweb.ucla.edu/Abstracts/Boesch_Tomasello_98.html)
Diese Darstellung leidet zunächst an ihrem mentalistischen Vokabular. Es ist nicht feststellbar, ob die Tiere eine „Intention“ haben. Die Definition des Lehrens ist zu weit. Das Eingreifen des älteren Tieres in die Hantierungen des jungen ist noch kein Lehren. Das Bereitlegen der Werkzeuge für das Jungtier ist nur anekdotisch überliefert und bleibt Sache wohlwollender Interpretation. Besser wäre der Nachweis des Vormachens, d. h. das erwachsene Tier müßte sich vergewissern, wie weit die Nachahmung schon gelingt, und sein Verhalten danach ändern. Dies ließe sich am Blickverhalten eindeutig und objektiv beobachten. Nüsse und Werkzeuge zurückzulassen („bereitzulegen“, wie man deuten kann, aber nicht muß) ist nicht ausreichend.
Das Vormachen bestünde in einer Art Verstellung, d. h. das unterrichtende Tier würde eine Nuß knacken, nicht um sie zu essen, sondern nur auf den Erfolg hin, daß das Jungtier Nüsse knackt. Das ist nie beobachtet worden. „Eine Nuß knacken“ und „Zeigen, wie man eine Nuß knackt“ – das ist der Unterschied. Dasselbe gilt für die Werkzeugherstellung.
Anthropologisch ist diese Variante der Verstellung, des „Pretending“, eine Voraussetzung kultureller Überlieferung.
| Kommentare zu »Vormachen und Nachmachen« |
| Kommentar schreiben | neueste Kommentare zuoberst anzeigen | nach oben |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.02.2013 um 04.20 Uhr |
|
Neben dem Vormachen zu Lehrzwecken könnte man auch das Üben als eine funktionalisierte Spielart der Verstellung, des So-tun-als-ob betrachten. Tiere üben nicht. Darum wissen wir nicht, bis zu welchem Grade von Fingerfertigkeit es ein Schimpanse bringen könnte. Bei Menschen würde man auch nicht ohne weiteres vermuten, daß er Liszt spielen kann. Was sich in der Kulturgeschichte akkumuliert hat, sind nicht nur Artefakte, auf denen jeweils die nächste Generation aufbauen kann, sondern auch Fertigkeiten, die unter bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen immer weiter vervollkommnet und durch Vormachen und überwachtes Üben weitergegeben wurden. Ich rechne die Sprache auch dazu. Sie kann also meiner Ansicht nach nicht jedesmal neu erfunden werden, wie die Nativisten annehmen. Wir sehen, wie der Mensch Faustkeile 500.000 Jahre lang fast unverändert hergestellt hat, gewiß eine hohe Kunstfertigkeit, verglichen mit den Werkzeugen der Menschenaffen. Später sehen wir aber auch Kleinplastiken und Felszeichnungen, die ein viel weiter entwickeltes Können voraussetzen. Wozu wäre ein Mensch der Steinzeit, sagen wir vor 30.000 Jahren imstande gewesen? Hätte er mit dem akkumulierten Wissen und Können nicht auch Mikrochips herstellen können? Hätte er Liszt spielen können wie die ebenfalls spärlich bekleidete Yuja Wang? (Gibt es eigentlich Papua-Pianisten?) |
Kommentar von Wolfgang Wrase, verfaßt am 21.02.2013 um 07.44 Uhr |
|
Jared Diamond würde sagen: Natürlich wird es Papua-Pianisten geben, sobald Papua die Gelegenheit bekommen, sich von klein auf fürs Klavierspielen zu begeistern. (Vielleicht gibt es auch schon welche.) Aufgrund seiner vielen Besuche in Neuguinea als Vogelkundler und Anthropologe zählt Diamond viele Papua zu seinen besten Freunden und hat ihnen sein Meisterwerk Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies gewidmet. Einer dieser Neuguineer namens Yali hatte Diamond sinngemäß gefragt: "Warum habt ihr Weißen immer so viele Sachen und wir nicht?" Wieder zu Hause, mußte Diamond jahrelang nach der Antwort suchen und hat sie in Form des genannten Buches vorgelegt. Sein Beispiel waren Flugpiloten. Er hat seine Erfahrung mitgeteilt, daß manche Söhne der Steinzeitmenschen Flugkapitäne geworden sind. Es sind dieselben Menschen wie wir; inzwischen auch im Cockpit von Jumbojets anzutreffen, früher oder später auch auf der Konzertbühne. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.02.2013 um 12.01 Uhr |
|
Ich wollte wirklich wissen, ob es welche gibt. Wundern würde es mich natürlich nicht. Ich wollte nur auf das Irreführende des ersten Eindrucks hinweisen, wenn man Steinzeitkultur und Mikrochips nebeneinander sieht. Es sind dieselben Menschen, die das eine wie das andere machen. Daß Sprache auch solche Wege hinter sich haben könnte, ist in unserem Zusammenhang die eigentlich aufregende Möglichkeit. Dem Linguisten sind die Sprachen alle gleich lieb und teuer, aber es könnte ja trotzdem Unterschiede wie zwischen Faustkeil und Mikrochip geben. Ich neige dazu, Fachprosa (bis hin zur Formalisierung) und Fachgespräche für die jüngste Stufe der sprachlichen Entwicklung zu halten, Poesie, Musik und Tanz dagegen für die älteste. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.11.2013 um 06.24 Uhr |
|
Ich versuche eine Neuformulierung: Operante Konditionierung verändert das Verhalten, indem sie bestimmte Verhaltensweisen belohnt. Die Wirksamkeit dieses Verfahrens ist bei der Abrichtung von Tieren und in der Verhaltenstherapie erwiesen, seine Übertragung auf das menschliche Sprachverhalten scheint grundsätzlich möglich, doch ist ein experimenteller Nachweis hier naturgemäß schwierig, nicht zuletzt wegen moralischer Bedenken. Sagt ein kleines Kind ba und streckt die Hände nach einem Ball aus, dann bekommt es den Ball gereicht; später nur noch nach dem korrekten Artikulieren von Ball. Die Eltern brauchen jedoch nicht auf Zufallsäußerungen des Kindes zu warten, um sie zu belohnen, sondern führen neue Lautgebilde durch Vorsprechen in das Verhaltensrepertoire des Kindes ein. Manches wiederholt das Kind sofort, anderes nach einiger Zeit. Zeichen werden solche Verhaltenseinheiten aber erst dann, wenn sie unter funktionale Steuerung geraten, d. h. unter die Verstärkung durch einen Partner bei Anwesenheit diskriminierender Reize. Welchen Anteil die Nachahmung am Spracherwerb hat, ist umstritten. Unter dem Einfluß nativistischer Theorien war die Untersuchung des eigentlichen Lernens eine Zeitlang vernachlässigt worden, und man hatte sich daran gewöhnt, abschätzig von „simpler Nachahmung“ zu sprechen, die als zentraler Bestandteil einer angeblich überholten behavioristischen Lerntheorie galt. Selten wurde bedacht, daß Nachahmung selbst etwas Komplexes und Unverstandenes ist: „Es wird ausdrücklich postuliert, daß Spracherwerb nicht durch Imitation erklärt, nicht auf einfache Nachahmung zurückgeführt werden kann. Doch dazu muß kritisch angemerkt werden, daß diese Nachahmung selbst ein ungelöstes Problem ist. Was nützt also die Behauptung, daß Spracherwerb nicht auf einfache Nachahmung zurückzuführen ist, wenn wir nicht einmal vernünftig erklären können, wie diese Nachahmung zustande kommt.“ (Hans G. Tillmann/Phil Mansell: Phonetik. Stuttgart 1980:314. Vgl. auch Kim Sterelny: The Evolution and Evolvability of Culture. In: Denis Walsh (Hg.): Twenty-Five Years of Spandrels. Oxford.) Konrad Lorenz erinnert daran, daß Nachahmung wie z. B. Gesichterschneiden oft schon beim ersten Versuch ausgezeichnet gelinge, durch einen Spiegel nicht wesentlich unterstützt werde und bei Wiederholung oft nicht so gut gerate. Die physiologischen Grundlagen der Nachahmung sind kaum bekannt. Neuerdings werden „Spiegelneuronen“ für die unmittelbare Nachahmung verantwortlich gemacht, manchmal auch für Empathie und soziales Verhalten überhaupt; ein großer Teil der Diskussion findet in der Autismus-Forschung statt. Diese Entdeckung hat sogleich eine Fülle auch populärwissenschaftlicher Literatur hervorgebracht. Manche Autoren wollen die Geschichte der Menschheit damit erklären, andere leiten pädagogische Rezepte daraus ab; doch ist inzwischen eine gewisse Ernüchterung zu bemerken. Da Spiegelneuronen auch bei kaum oder gar nicht nachahmenden Tieren zu finden sind, scheint die physiologische Seite der Nachahmung weiterhin ungeklärt zu sein. Zu den überraschenden Einsichten der neueren Forschung gehört, daß Nachahmung bei nichtmenschlichen Lebewesen selten vorkommt und das für den Menschen so wichtige Vormachen anscheinend überhaupt nicht. („Nichtmenschliche Primaten lehren nicht.“ [Michael Tomasello: Die kulturelle Entwicklung des Denkens. Frankfurt 2003:3] - Über die große Bedeutung des Lehrens durch Vormachen s. S. A. Barnett: Homo docens. J. biosoc. Sci. 1973, 5:393-403.) Vormachen ist eine Voraussetzung für die genaue Weitergabe von erlernten Fertigkeiten. Es setzt seinerseits die Fähigkeit zur Verstellung voraus. In der Verstellung wird ein Verhalten gewissermaßen „zitiert“, also nur vorgeführt und nicht in seiner eigentlichen Funktion ausgeübt. Verstellungsspiel ist bei höheren Tieren verbreitet, wird aber nur beim Menschen in den Dienst der Unterweisung gestellt. Der Vormachende läßt sich beim Vorführen einer bestimmten Fertigkeit nicht allein von der Zweckmäßigkeit der Ausübung leiten, an der er im Augenblick wenig oder gar nicht interessiert ist, sondern „vergewissert“ sich außerdem, daß der Lernende ihm folgt, ihn also gegebenenfalls nachahmt, und verhält sich so, daß dies geschieht: Das Verhalten des Nachahmenden steuert das Verhalten des Vormachenden. Diese Rückkoppelung ist bei Tieren nicht beobachtet worden. (Eine Verhaltensanalyse des Vormachens und Nachahmens gibt Skinner in „The evolution of verbal behavior“. JEAB 1986:115-122.) Auch der Lernende verwechselt das Vormachen nicht mit dem Ernstfall. Kinder sind erstaunlich früh imstande, ein So-tun-als-ob richtig zu deuten, nach Hetzer spätestens um die Mitte des zweiten Lebensjahres. Hildegard Hetzer: Die symbolische Darstellung in der frühen Kindheit. Wien 1926:22. - Hierzu eine eigene Beobachtung: Ein Mädchen von 15 Monaten wirft immer wieder eine Plüschmaus hinter sich, „sucht“ mit übertriebenen Kopfbewegungen danach, „findet“ sie und holt sie mit einem triumphierenden Da-isse Maus! zu sich heran. Angeline Lillard setzt „pretend play“ erst mit 18 bis 24 Monaten an. Sie schreibt ferner: „Unlike many other innate behaviors, pretend play does not serve any obvious survival function.“ („Pretend play and cognitive development“. In: Usha Goswami [Hg.]: Blackwell handbook of child cognitive development. Oxford 2002:188-205, S. 189) Eine solche Funktion ist nach dem Obengesagten sehr wohl zu erkennen. Hierzu gehört auch das Versteckspiel, ein fingiertes Verlorengehen und Wiedergefundenwerden. Durch Vormachen kann eine große Zahl von Verhaltensweisen in das Repertoire eines Lernenden eingeführt werden, darunter die vielen tausend Wörter einer Sprache. Auch Wörterbücher gehören zu den lehrreichen Fiktionen, da sie die Wörter nicht gebrauchen, sondern vorführen. Redewiedergabe ist ebenfalls eine Art des Verstellungsspiels, und sogar die „versetzte Rede“ etwa in Berichten über Nichtgegenwärtiges läßt sich ohne einen gewissen Anteil von Verstellung nicht denken. Nur durch Nachahmung ist auch zu erklären, daß die Kinder die Sprechweise der Eltern bis in die feinsten regionalen Besonderheiten übernehmen, die Klangfarbe der Vokale, die Satzmelodie, oft sogar erkennbar eine familieneigentümliche Artikulation, jedenfalls weit mehr, als für die bloße Verständigung erforderlich wäre. Diese Feinheiten unterliegen, soweit man es beobachten kann, nicht dem Mechanismus der selektiven Bekräftigung aufeinander folgender Annäherungen (shaping), sind daher nur durch Nachahmung zu erklären. Das Nachahmungsverhalten wird anscheinend ganz allgemein wegen seines Nutzens verstärkt. Man unterscheidet unmittelbare und verzögerte Nachahmung (Meltzoff/Prinz). Skinner hatte in ähnlichem Sinne das Echoverhalten von der eigentlichen Imitation getrennt. Bei Säuglingen kann im Alter von zwei bis drei Wochen eine mimische Nachahmung, das Vorstrecken von Lippen und Zunge, das Öffnen des Mundes oder bestimmte Augenbewegungen, beobachtet werden. Nach Byrne handelt es sich dabei lediglich um das Auslösen von Verhaltensweisen aus einem bereits bestehenden Repertoire (response facilitation), während bei echtem Nachahmen auch neue Verhaltensweisen entstehen. Auch die oft beschriebene Traditionsbildung bei Tieren (englische Blaumeisen öffnen die Verschlußkappen von Milchflaschen, japanische Affen waschen und würzen Süßkartoffeln im Meerwasser, afrikanische Affen stellen Werkzeuge her und benutzen sie zum Termitenangeln oder Nüsseknacken) könnte auf scheinbarer Nachahmung beruhen, die sich bei näherer Untersuchung als „stimulus enhancement“ (Byrne) erweist. Das beobachtende Tier wird lediglich auf bestimmte Reize aufmerksam gemacht und entwickelt dann unter identischen Bedinungen selbst die erfolgreiche Verhaltensweise seiner Genossen, die dem Beobachter als nachgeahmt erscheint. Dafür spricht auch, daß es gewöhnlich zu einem langen Herumprobieren kommt, im Gegensatz zur unmittelbaren Abfolge von Beobachten und Nachmachen, wie wir es etwa bei Menschenkindern kennen. Insgesamt ist Nachahmung bei Tieren überraschend selten. Beim Menschen ist sie entscheidend für die Akkumulation kultureller Neuerungen. (Vgl. Ernst Peter Fischer/Klaus Weigandt: Evolution. Geschichte und Zukunft des Lebens. Frankfurt 2003:364f.) Zur Erlernung des Nachahmens gehört, daß nicht alles nachgeahmt wird. Was der andere nur versehentlich tut, wird meistens nicht nachgeahmt. Man hat daraus geschlossen, nicht das Verhalten, sondern die dahinterstehende Absicht werde nachgeahmt. Eine solche mentalistische Annahme ist jedoch unnötig. Das „beabsichtigte“ Verhalten ist im allgemeinen durchaus von versehentlichem zu unterscheiden. Man begleitet es zum Beispiel oft mit Selbstkommentaren wie so (there) einerseits, hoppla (whoops) andererseits. Kinder sind spätestens im zweiten Lebensjahr imstande, solche Signale zu deuten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.07.2014 um 09.05 Uhr |
|
Es ist anzunehmen, daß Störche nicht losfliegen könnten, wenn sie nicht vorher eine Weile geübt hätten. Aber das ist kein Üben in dem Sinne, wie ich es als Sonderform der Verstellung (pretending) beschrieben habe. Der junge Storch tut nicht so, als ob er fliege, sondern "fliegt" allen Ernstes, nur klappt es noch nicht so richtig (no pun intended). Außerdem kann der Klapperstorch gar nicht anders. Das Üben als Tun-als-ob ist rein menschlich. Ob es stets durch soziale Faktoren gestützt werden muß oder auch spontan vorkommt, ist eine andere Frage. Wenn ein Kind allein im Bett liegt und Sprachlaute "übt" - worin besteht die Verstärkung, die zu einem Konditionierungserfolg führt? Vielleicht im Hören der eigenen Artikulationen, die ja auch aufhören, wenn das Kind gehörlos ist. Diese Rückkoppelung könnte man "Funktionslust" nennen (mit Karl Bühler, nicht Konrad Lorenz, wie manche meinen). Aber nötig ist es natürlich nicht, wenn man behavioristisch denkt. Skinner spricht von automatischer Selbstverstärkung. Das Üben ist ganz überwiegend im Zusammenhang mit Musik untersucht worden, dann auch an Sporthochschulen. Wer ein Instrument übt, wird durch den Genuß des gelungenen Spiels belohnt. Das spielt er dann gleich noch mal und kann es dadurch immer besser. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.10.2014 um 18.10 Uhr |
|
Nach etwas windigen Forschungen lernen Schimpansen durch Nachahmung voneinander. Bezeichnend der Ton einiger Leserbriefe (online): Gigantischer wissenschaftlicher Fortschritt Ich bin bin sprachlos! Primaten lernen durch Nachahmen. Darauf muss man erstmal kommen. Ein anderer fragt, ob für so etwas Forschungsgelder ausgegeben werden müssen usw. Das zeigt wieder einmal, wie sehr das eingebildete Wissen (Affen äffen doch wohl nach!!) der Bildung im Wege steht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.10.2014 um 11.01 Uhr |
|
Dawkins ist kritisch, was Märchen für Kinder betrifft. Er möchte sie zu kleinen Skeptikern erziehen. Ich weiß nicht, wie ernst er es meint, aber das scheint mir zu eng zu sein. Wie man weiß, bringen Kinder im allgemeinen Märchen und Wirklichkeit nicht durcheinander. Dafür sorgt die Struktur der meisten Märchen, worauf besonders Harald Weinrich in seinem Tempus-Buch hingewiesen hat. Das Märchen leitet mehr oder weniger deutlich in eine Welt, die nicht zur Lebenswirklichkeit des Kindes gehört (Es war einmal...), und es leitet auch wieder heraus (Mein Märchen ist aus/Und wenn sie nicht gestorben sind). Dies gehört in den Bereich des Verstellens, Vormachens und Nachahmens und ist für die Entwicklung des Kindes sehr wichtig. (Paul Bloom hat zum Pretending neuerdings gute Arbeiten veröffentlicht.) Man beobachte das Fiktionsspiel der Kinder. Dabei lernen sie etwas. Anders könnte es mit nichtmärchenhaften falschen Erklärungen der Wirklichkeit sein. Ich habe anderswo den Regenbogen erwähnt, weil ich jemanden kenne, der auch als Erwachsener noch Probleme damit hat, weil der eigene Vater es sich mal ein bißchen zu leicht gemacht hat... |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.10.2014 um 07.14 Uhr |
|
In fiktionalen Texten wird, wie Weinrich gezeigt hat, die Fiktionalität durch obstinate Tempussignale (und anderes) markiert, so daß es nicht zu einer Verwechslung mit der Lebenswirklichkeit kommt. Seit wir die visuellen Medien haben, tritt als Äquivalent die Musikuntermalung auf. (Darüber haben wir schon kritisch gesprochen, soweit es Dokumentationen betrifft.) Schon Kinder lernen, daß den Ereignissen im Fernsehen eine Musikspur unterlegt ist, dem wirklichen Spielen, der Zeugnisausgabe und den väterlichen Watschen hingegen nicht.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.10.2014 um 17.44 Uhr |
|
Zu den angeblich nachahmenden Schimpansen: Man muß, wie gesagt, vorsichtig sein mit der Deutung. Ich komme noch einmal auf die Blaumeisen zurück, die Stanniolkappen von Milchflaschen abzogen und das scheinbar von anderen lernten. Blaumeisen ziehen auch Rinde von Bäumen ab, dieses Verhalten ist also an sich nicht neu. Wenn eine zufällig eine Stanniolkappe abgezogen hat, kann dieses Verhalten bei den gesellig lebenden Vöglen zu dem erwähnten "Stimulus enhancement" führen, und das sieht dann wie Nachahmung aus. Neues Verhalten wird bei Tieren nicht durch Nachahmung eingeführt, wohl aber beim Menschen in größtem Umfang.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.12.2014 um 13.08 Uhr |
|
Das menschenspezifische Lehren durch Vormachen (und verwandtes Verhalten) ist besonders von Gergely und Csibra untersucht worden. Sie nennen es "natürliche Pädagogik" und betrachten es als evolutionäre Neuerung. (Einiges davon ist leicht im Internet zu finden.) Leider ist die Darstellung weitgehend mentalistisch. Aber es sind nicht "induktive Schlußfolgerungen" usw., die unter Selektionsdruck geraten, sondern Verhaltensweisen. Auch mit Codes und Repräsentationen läßt sich nichts anfangen: The most unique proposal of the theory of natural pedagogy is the hypothesis that the information extracted from the other’s ostensive-referential communication is encoded and represented qualitatively differently from the interpretation of the same behaviour when it is observed being performed in a non-communicative context. Das müßte alles entsprechend umgearbeitet werden, damit es einer biologischen Untersuchung zugänglich wird. Die Kinder nehmen objektiv beschreibbare Signale wahr, die z. B. das lehrende Vormachen vom bloßen Ausführen einer Handlung unterscheiden, und reagieren entsprechend unterschiedlich. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.01.2015 um 06.59 Uhr |
|
Man hat nach dem Ursprung der Sprache gesucht und dazu das Experimentum crucis ersonnen: Kinder ohne sprachliches Vorbild aufwachsen zu lassen oder Wolfskinder zu untersuchen und dann zu sehen, was sich "von selbst" entwickelt haben könnte. (Das Scheitern der Experimente ist ein anderes Kapitel, ebenso die Unzuverlässigkeit der Wolfskinderberichte.) Was man nicht so oft fragt: Welche anderen Fertigkeiten würde denn ein Mensch ohne Unterweisung, also hauptsächlich Vormachen, erwerben? Wir sehen die kleinen Kinder "üben", nämlich im Spiel. Aber dazu brauchen sie diesen Freiraum, der auch nicht derselbe ist wie der der kleinen Affen, wenn sie gerade mal nicht mit Fressen, Schlafen und "social grooming" beschäftigt sind. (Wieviel Üben steckt in der Fellpflege, was ist angeboren?) Sieht man den Menschen nackt und bloß, würde man die Höchstleistungen eines Pianisten nicht ohne weiteres für möglich halten. Mehre tausend Übungsstunden unter vielfältiger Kontrolle wirken Wunder. Sprache wird noch sehr viel intensiver geübt, kein Wunder, daß sie so kompliziert ist und viele Linguisten in Arbeit und Brot setzt. Die Nativisten sagen: Sprache ist so komplex, das kann nicht erlernt, muß also angeboren sein. Die Empiristen sagen: Sprache ist so komplex, das kann nicht angeboren, muß also erlernt sein. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 07.01.2015 um 14.21 Uhr |
|
Daß Pferden, Glühwürmchen und selbst Papageien das Talent zu gepflegter Konversation abgeht, ist allerdings auch eine empirische Beobachtung. Man muß ja nicht gleich in Lamarckismus abgleiten, wenn man daraus auf angeborene Fähigkeiten schließt.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.01.2015 um 17.01 Uhr |
|
Was ich meine, steht ähnlich in einem Aufsatz Skinners (http://www.biolinguagem.com/ling_cog_cult/skinner_1986_evolution_verbalbehavior.pdf), aus dem ich hier zitiere: "Organisms must have profited from the behavior of each other at a very early stage through imitation. To imitate is more than to do what another organism is doing. Pigeons foraging in a park are not imitating each other to any great extent; they are acting independently under similar environmental contingencies. To imitate is to act as another organism is acting because important consequences have then followed. The evolution of the process can be traced to plausible selective consequences: The contingencies responsible for the imitated behavior may affect another organism when it behaves in the same way. Thus, if one of two grazing animals sees a predator and runs, the other is more likely to escape if it runs too, although it has not seen the predator. Running whenever another organism runs usually has survival value. It was only after a tendency to imitate had evolved that contingencies existed for the evolution of the reciprocal process of modeling. A young bird that would eventually learn to fly without help learns sooner when it imitates a flying bird. Its parents can speed the process by flying where the young bird can see them and in ways that are easily imitated. To say that the parents are "showing their young how to fly" adds nothing to such an account and may imply more than is actually involved.““(...) Contingencies of reinforcement resemble contingencies of survival in many ways. Animals learn to imitate when, by doing what others are doing, they are affected by the same contingencies - of reinforcement rather than of survival. Once that has happened, contingencies exist in which others learn to model to behave in ways that can be more easily imitated. If, for example, a door can be opened only by sliding it to one side, rather than pushing or pulling it, a person slides it when he sees another person do so, although the other person is not necessarily modeling the behavior. In such an example, both parties may exhibit traces of phylogenic imitation or modeling, but the operant contingencies would suffice. If the modeler is not close to the door, he can make the kind of movement that would open it if he were - as a gesture. To say that he is "showing the other how to open the door" is useful in casual discourse but, again, potentially troublesome in a scientific account.“ |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.11.2015 um 09.13 Uhr |
|
Noch einmal zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1507#24391 http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1507#26978 Beobachtung an einem jungen Hund: Er scheint sich besonders für alle Gegenstände zu interessieren, für die sich die Menschen interessieren. Ähnliches habe ich bei unseren Töchtern beobachtet, als sie noch im Krabbelalter waren. Bücher müssen etwas ganz Besonderes sein, sonst würden sich die Eltern ja nicht den ganzen Tag damit beschäftigen usw. Das ist biologisch durchaus sinnvoll, auch wenn es nicht Nachahmung ist, sondern gesteigertes "Stimulus enhancement". Aus den meisten Berichten über Nachahmung bei Tieren geht nicht hervor, daß die Autoren sich der Unterscheidung bewußt sind. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.05.2016 um 18.35 Uhr |
|
Wie bei Wikipedia zutreffend berichtet wird, hat Konrad Lorenz die "Prägung" bei Vögeln nicht entdeckt, auch nicht Heinroth. Als frühester Beleg (aber nicht als Entdeckung) wird Thomas Morus angeführt. Zufällig lese ich bei Hermann von Helmholtz, daß er 1868 den Sachverhalt beiläufig als eine bekannte Tatsache erwähnt: „So schliesst sich ein Hühnchen, das vor dem fünften Tage keine Henne gefunden hat, einem Menschen an, der es pflegt, und folgt dann nicht mehr der Henne.“ Helmholtz vertritt seinen empiristischen Standpunkt sehr geschickt, auch heute noch gegen jeden Nativismus verwendbar. Die mühsam erworbene Koordination von Auge und Hand beim Kleinkind zum Beispiel. Dazu eine ganz moderne Beobachtung zu "pädagogisch wertvollem" Spielzeug: „Das Kind fängt zuerst an mit seinen Händen zu spielen; es giebt eine Zeit, wo es diese und seine Augen noch nicht nach einem glänzenden oder farbigen Gegenstande, der seine Aufmerksamkeit erregt, hinzuwenden weiss. Später greift es nach Gegenständen, wendet diese immer wieder um und um, besieht, betastet, beleckt sie von allen Seiten. Die einfachsten sind ihm die liebsten; das primitivste Spielzeug macht immer mehr Glück als die raffinirtesten Erfindungen moderner Industrie in diesem Fache.“ |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.08.2016 um 09.57 Uhr |
|
Zu einem Gedanken, den ich an verschiedenen Stellen angedeutet habe (z. B. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1337#30796 und http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=390#21651): Bei Ausgrabungen bronzezeitlicher Siedlungen in Spanien hat man Gefäße gefunden, die 650 Jahre lang genau gleich hergestellt wurden, „als habe auf innovatives Design die Todesstrafe gestanden.“ (FAS 31.7.16) Vielleicht nicht gerade die Todesstrafe, aber daß solche Verfahren unter starkem sozialen Druck immer in genau derselben Weise geübt werden durften, nehme ich auch an, übertrage es auch auf die sprachlichen Umgangsformen. Ritualisierung erzeugt Sicherheit, hemmt allerdings auch den Fortschritt. Wie man spricht, wie man töpfert, wie man betet – das war allen klar und wurde manchmal 100 oder auch 500 000 Jahre nicht in Frage gestellt. Wie regen sich manche Leute auf, wenn einer ein klein wenig anders spricht, z. B. einen falschen Dativ gebraucht! Die Heftigkeit wäre einer Ketzerverfolgung würdig. So auch in der Mode. Familien sind zerbrochen, weil der Nachwuchs nicht von Beatles-Frisuren lassen wollte. (Schließlich mußten Stahlhelm und Gasmaske einwandfrei sitzen...) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.07.2017 um 06.51 Uhr |
|
Frontbericht. Die Enkelin (3 Monate alt) hat bisher außer Schreien, wenn ihr was fehlt, kaum Töne von sich gegeben. Das ändert sich gerade. Wenn man ihr etwas vorsingt, kräht sie mit einer gewissen Regelmäßigkeit los. Wahrscheinlich hat sie schon gemerkt, daß diese Stimme ihre eigene ist, auch wenn sie außer An- und Abschalten noch keine Kontrolle darüber hat. Steuerung des eigenen Verhaltens unter der Mitwirkung eines weiteren "Inputs" (diskriminierenden Reizes). Das ist die Grundfigur der Konditionierung. Ich hole die Beobachtungen nach, die in den Protokollen zu den eigenen Töchtern fehlen. (Geht hin und tut desgleichen!) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.09.2017 um 12.06 Uhr |
|
Prähistoriker streiten darüber, ob die Menschen der älteren Steinzeit ihr Werkzeuge „intentional“ hergestellt haben oder nicht. Das ist wegen der Unklarheit dieses Begriffs kaum entscheidbar. Aus meiner Sicht läuft es darauf hinaus, ob die Menschen ihr Verhalten vorher angekündigt und damit zur Diskussion gestellt haben. Aber wer kann das sagen? Auch sind viele Formen einer solchen Ankündigung möglich. Da die Kunst der Steinbearbeitung eine lange Entwicklung voraussetzt, muß es Lehrende und Lernende gegeben haben. Es kann sein, daß der Meister den Schüler zurechtwies, wenn er falsche Schläge setzte. Nachmachen versteht sich auch nicht von selbst („Homo docens“, vgl. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1507#24391). Man sagt metaphorisch, daß dem Hersteller das Herzustellende irgendwie vorgeschwebt haben muß, aber das ist keine Erklärung, auch nicht, wennn man es mit dem beliebten Wort „Repräsentation“ aufpeppt. Vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/Knapping
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.01.2018 um 05.43 Uhr |
|
„Die Komödie sucht schlechtere, die Tragödie bessere Menschen nachzuahmen, als sie in der Wirklichkeit vorkommen.“ So wird die Stelle aus der Poetik des Aristoteles gewöhnlich übersetzt, hier von Manfred Fuhrmann. Darauf beruht die ganze "Mimesis"-Theorie. Aber das kann ja gar nicht stimmen. Was nicht existiert, kann man auch nicht nachahmen. Mimesis heißt "Darstellung", vielleicht auch "Fiktion". (Ich habe mich immer gewundert, daß niemandem schon rein sprachlich die Härte aufzufallen scheint: "etwas nachahmen, was es nicht gibt"...) Grundlage ist die Fähigkeit, so zu tun als ob, also Verstellung. Verstellungsverhalten tritt in den Dienst höherrangiger Funktionen, z. B. auch als Vormachen zu Unterrichtszwecken ("Homo docens"). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.01.2018 um 07.19 Uhr |
|
Was wir als Nachahmung deuten, ist, wie gesagt, oft etwas anderes. Darüber ist viel geschrieben worden. Besonders gut Noble/Todd: http://web.media.mit.edu/~cynthiab/Readings/Noble-Todd02.pdf Die Autoren warnen davor, etwas auf höherer Ebene (z. B. intentional) zu erklären, was sich auf einer niederen erklären läßt. (Vgl. meine Ausführungen zu Planimeter und Bienen.) Much of the work that professes to be about mechanisms of social learning does not really confront this challenge. For example, Bandura (1969) discusses the process of “identification,” whereby a human observer comes to adopt the attitudes and behaviours of a model. Tomasello et al. (1993) talk about “perspective taking” as being central to the ability to truly imitate another. In neither of these cases do the authors go any further than labelling the phenomenon; we are left in the dark as to just how identification or perspective taking might be achieved. Sehr treffend. Bei Tomasello gibt es gute Ansätze, aber der mentalistische Irrweg schränkt den Nutzen seiner Arbeiten stark ein. Zwischenbericht von der Enkelin: Mit 8 Monaten scheint sie nachzuahmen, wenn man mit der flachen Hand auf den Tisch schlägt. In Wirklichkeit hat sie damit angefangen, und der Erwachsene ahmt sie nach im Sinne des "biologischen Spiegels" (Papousek). Dadurch erfährt sie besser, was sie eigentlich selbst gerade getan hat, freut sich erkennbar und wiederholt es. Ihr Verhalten wird durch die zusätzliche Rückmeldung (zusätzlich zum selbsterzeugten Lärm) klarer konturiert, aus dem übrigen herausgehoben. Auch blickt das Kind dabei seinen Spielpartner freudig an, es ist also etwas Kommunikatives daran. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.01.2018 um 06.26 Uhr |
|
Wenn man nicht schon wie Tomasello entschlossen ist, beim Kind mit etwa 9 Monaten eine "Revolution" der "kognitiven Entwicklung" zu beobachten, findet man auch nichts. Das kleine Mädchen hat allmählich den Rollentausch gelernt: Erst schlägt sie auf den Tisch, dann die Mutter, dann wieder sie usw.; mit freudiger Erwartung den anderen anblickend. Es gibt keinen Grund, dem Kind eine "theory of mind" zu unterstellen, mit der auch nichts wirklich erklärt wäre (s. das Zitat im vorigen Eintrag). Der ganze aufwendige Apparat der Kognitivsten ist überflüssig und daher schädlich.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.02.2018 um 05.36 Uhr |
|
Zur Ritualisierung (verhaltensbiologisch): Das Kopfschütteln und Kopfnicken des Menschen gilt heute als Verneinung bzw. Bejahung einer Handlung. Früher galt das Kopfschütteln als Brustverweigerung, sobald der Säugling gesättigt ist. Das Kopfnicken galt früher als Unterwerfungsgeste, um dem Gegenüber zu signalisieren, dass man ihm recht gibt. (https://abitur-wissen.org/index.php/biologie/verhaltensbiologie/55-verhaltensbiologie-ritualisierung) Klingt einleuchtend, auch wenn man es nicht beweisen kann. Lassen wir die bekannten kulturellen Unterschiede beiseite, bleibt eine Schwierigkeit: Das Rechtgeben durch Kopfnicken bzw. -neigen stammt aus einer ganz anderen Lebensphase als das Verweigern der Mutterbrust. Diese Kluft könnte allenfalls durch die Einsicht überbrückt werden, daß Verneinen und Bejahen viel verschiedener sind, als man denkt. Wie es denn auch in den meisten Sprachen eigene Zeichen für Verneinung, aber nicht für Bejahung gibt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.02.2018 um 13.35 Uhr |
|
Wenn man dem Kind (10 Monate) ein Tuch über das Gesicht hängt, lacht es geradezu wild und jedesmal wieder. Eigentlich ist das Verhängen angsterregend, aber das Kind hat gelernt, daß es das Tuch jederzeit herunterziehen kann und dann die ganze Umgebung so ist wie zuvor. Die Überwindung der Angst, der Gewinn an souveräner Beherrschung der Dinge löst eine Art Angstlust und eben das Lachen aus. Nach einiger Zeit verlängert es die Dauer der Deprivation und möchte gar nicht sofort befreit werden, sondern die Situation auskosten. Dieses Grundmuster bleibt erhalten und ist noch im Lachen über Witze nachweisbar. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.02.2018 um 05.05 Uhr |
|
Das logische Verhältnis von Vormachen, Nachmachen, Verstellung muß geklärt werden. (Ich meine hier immer das lehrende Vormachen: Zeigen, wie es geht; vgl. "Homo docens".) Vormachen konnte evolutionär oder kulturell (das bleibt noch zu untersuchen) nur seligiert werden, wo es Nachmachen gibt. Sonst würde es gleichsam wirkungslos verpuffen. Das Vormachen ist eine Art von Verstellung. Wenn ich dem Kind zeige, wie man Schuhe bindet oder Buchstaben malt, tue ich selbst nur so, als bände ich Schuhe oder schriebe Buchstaben, aber dieses Verhalten ist aus seinem funktionalen Zusammenhang herausgelöst und wird nur vorgeführt. Verstellungsspiel, Pretence play ist bekanntlich bei höheren Tieren allgegenwärtig, erst recht beim Menschen (ab etwa 8 Monaten, wie hier schon vielfach erörtert). Aber nur beim Menschen wird es "in den Dienst" des Lehrens gestellt. Also ein Fall von Exaptation: Umfunktionieren einer anderweitig entstandenen Verhaltensweise. Zum lehrenden Vormachen gehört, um es noch einmal zu sagen, die Rückkoppelung: Ich beobachte, wie weit das Kind mit dem Nachmachen ist, und forme sein Verhalten durch weiteres Vormachen und entsprechende Hinweise (Shaping). Wir müssen ganz runter zu den Elementen des Verhaltens, dürfen uns nicht vom kulturellen Überbau der akkumulierten Fertigkeiten und Artefakte blenden lassen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.02.2018 um 06.08 Uhr |
|
Die Erde lief schon um die Sonne, als noch keine Menschen es erkannt hatten. Aber daraus folgt nicht, daß die Proposition, die das „ausdrückt“, schon wahr war. Die Proposition ist ein menschliches Verhalten unter der Steuerung von Faktoren wie – in diesem Fall – dem Lauf der Erde um die Sonne. Dieses Verhalten hat es nicht gegeben, als es noch keine Menschen gab. Der Mensch erkennt den Lauf der Erde, nicht die in einem Ideenreich existierende Proposition, sondern diese ist seine Reaktion darauf. (Auch gegen Spaemanns kindischen „Gottesbeweis aus der Grammatik“.) Aus Wikipedia: Unter einem Satzradikal versteht man in der Sprechakttheorie die gemeinsame Beschreibung eines Sachverhaltes (Proposition) in verschiedenen Satztypen mit gleichem lexikalischem Inhalt, d. h. denselben Lexemen mit derselben syntaktischen Verknüpfung. Das Gegenstück zu diesem Begriff ist der Satzmodus, etwa: Frage- (oder Interrogativ), Aussage- (oder Deklarativ) oder Aufforderungssatz (oder Imperativ). Das Begriffspaar Satzradikal/Satzmodus stammt von dem finnischen Philosophen Erik Stenius, der sich dabei auf eine Begriffsbildung von Ludwig Wittgenstein bezieht [s.u.]. Die entsprechende theoretische Unterscheidung geht auf Gottlob Frege zurück. Während im Satzradikal der wahrheitsfunktionale Inhalt eines Satzes oder seine Proposition wiedergegeben wird – man kann sie in einer wahrheitswertfunktionalen Semantik erfassen – zeigt der Modus eines Satzes den jeweiligen Typ oder was der Fall ist des Sprechaktes an. Beispielsweise enthalten die Sätze: Lola rennt. Rennt Lola? Lola, renn! als gemeinsames Satzradikal (der deskriptive Gehalt der Versprachlichung) „das Rennen von Lola“, ausgedrückt durch die Lexeme „Lola“ und „rennen“ sowie ihre Verknüpfung als Subjekt (hier auch Agens) und Prädikat. Sie unterscheiden sich jedoch im Satzmodus (Modus, der den Sinn des Satzes bestimmt): Im ersten Fall handelt es sich um einen Aussagesatz, im zweiten um einen Fragesatz, im dritten um einen Aufforderungssatz. (Die nominalisierende Umschreibung „das Rennen von Lola“ ist nicht richtig, da nicht satzförmig; sie widerspricht ja auch der Erklärung.) Die Herauslösung eines Satzes, der nur angeführt, nicht behauptet wird, ist ein Fall von Verstellung. Man tut so, als sage man etwas aus, meint es aber nicht, sondern führt es nur vor. – So läßt sich der Platonismus der heute weithin herrschenden Fregeschen Theorie naturalisieren. Denken wir uns ein Bild, einen Boxer in bestimmter Kampfstellung darstellend. Dieses Bild kann nun dazu gebraucht werden, um jemand mitzuteilen, wie er stehen, sich halten soll; oder, wie er sich nicht halten soll; oder, wie ein bestimmter Mann dort und dort gestanden hat; oder etc. etc. Man könnte dieses Bild (chemisch gesprochen) ein Satzradikal nennen. Ähnlich dachte sich wohl Frege die »Annahme«. (Wittgenstein PU 22) Vgl. auch Skinner: Diese Beschäftigung mit der Form hat nicht zu einer zufriedenstellenden Behandlung des Inhalts unseres Denkens geführt, aber die „Tatsachen“, „Propositionen“ und andere „Bezugsgrößen von Aussagen“ werden durch die steuernden Variablen angemessen repräsentiert. (VB 451) (usw.) |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 19.02.2018 um 09.59 Uhr |
|
Das Bild des Boxers ist aber erst recht nicht satzförmig. Also ist nicht die Umschreibung "das Rennen von Lola" kein zutreffendes Satzradikal, sondern die Erklärung von Wikipedia, das Satzradikal sei eine Beschreibung in Satztypen, ist falsch. Verstehe ich das richtig?
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 19.02.2018 um 10.41 Uhr |
|
Wir wissen, daß sich vor einer Milliarde Jahren schon die Erde um die Sonne gedreht hat, aber der Satz "Die Erde dreht sich um die Sonne" war damals noch nicht wahr, weil noch niemand ihn gesagt hat – ist das nicht bloße Wortklauberei?
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.02.2018 um 10.57 Uhr |
|
Ja, sicher, das meine ich ja auch. Aber der Idealismus oder Platonismus war für den Mathematiker Frege sehr verlockend. Lassen wir den "Satz" (scheinbar) weg, dann könnte man sagen: Schon bevor es Menschen gab, war es wahr, daß das Quadrat über der Hypotenuse gleich der Summe der Quadrate über den Katheten war/ist... Aber was bedeutet das eigentlich? Zu Wittgenstein: Das ist ja nur eine Erläuterung, der Boxer oder seine Abbildung ist natürlich kein Satzradikal, ein Begriff, der hier eingeführt wird (der Grund meines Zitats). Ich glaube, die Analogie ist so: Was der Mann in Boxhaltung gerade tut, ist offen, solange man die Geschichte drumherum nicht kennt. Bei Sätzen muß man das Sprachspiel kennen, in das sie eingebettet sind. Skinner unterscheidet zwischen Topographie (Form) und Funktion. Man könnte rekonstruieren: Die Verbindung von Satzradikal und Satzmodus nach Stenius ist dieselbe wie die zwischen künstlich herausgeschnittenem Ausdruck und Sprachspiel. Und die "Anthropologie" des Herausschneidens ist das Verstellungsspiel. |
Kommentar von Klaus Achenbach, verfaßt am 19.02.2018 um 14.57 Uhr |
|
Vor einer Millarde Jahren gab es noch überhaupt keine "Propositionen", die wahr oder falsch hätten sein können. Was ist dazu mehr zu sagen?
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 19.02.2018 um 16.39 Uhr |
|
Gibt es den Satz des Pythagoras erst seit Pythagoras oder schon seit zum ersten Mal ein Mensch einen Baumstamm senkrecht auf einen anderen setzte, es kannte ihn nur noch niemand, oder doch schon seit dem Urknall, es war nur noch niemand da, der ihn hätte kennen können? Ich meine das letztere.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.02.2018 um 16.48 Uhr |
|
Ja, so denken viele, aber ich bin mit Herrn Achenbach der Meinung, daß das keinen rechten Sinn hat. Die Tatsache, die der Satz des Pythagoras ausdrückt, gab es schon immer, aber den "Satz"? Was soll das bedeuten? Nur in der Philosophie der Mathematik wird das noch ernsthaft diskutiert. Wird der Lehrsatz entdeckt oder erfunden? Der Sachverhalt wird entdeckt, sein sprachlicher Ausdruck wird erfunden. Nach Skinner (und Ickler) ist Mathematik ein menschliches Sprachverhalten und eine Art gemeinschaftliche Anpassung an die Welt, wie sie ist – wie die Logik. (Aber ich weiß, und wir haben es hier schon einmal diskutiert, daß es andere Auffassungen gibt. Allerdings haben solche Differenzen auf die mathematische Praxis keine Auswirkungen.) |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 19.02.2018 um 18.03 Uhr |
|
Der Satz, die Aussage, die Tatsache, der Sachverhalt - darin sehe ich keinen wesentlichen Unterschied. Man kann wohl bestimmte Feinheiten definieren, etwa: Tatsachen sind wahre Sachverhalte. Der Satz (Aussage) ist die sprachliche Beschreibung eines Sachverhalts. Wahre Sätze beschreiben Tatsachen. Auch rein logische Zusammenhänge würde ich zu den Sachverhalten zählen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.02.2018 um 19.51 Uhr |
|
Für mich ist der Unterschied zwischen einem Sachverhalt (einem Stück Wirklichkeit) und seiner Beschreibung ein Unterschied ums Ganze. Ich könnte meinen Beruf aufgeben, wenn ich es anders sähe.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 19.02.2018 um 20.40 Uhr |
|
Ich bin sehr froh, daß Sie diesen Beruf gewählt haben, lieber Prof. Ickler. Der besagte Unterschied ist vielleicht nur aus Sicht eines Mathematikers eine Feinheit, ich habe das etwas zu schnell geschrieben. Was ich meine, es gibt eine Entsprechung. Jede Tatsache kann in Form einer Beschreibung, eines Satzes, sprachlich ausgedrückt werden. Die Beschreibung kann nichts dafür, wenn gerade niemand da ist, der sie formuliert. Der Wahrheitsgehalt oder der Sinn eines Satzes (einer Aussage, einer Idee) richtet sich nach seiner Entsprechung in der Wirklichkeit. Es wäre m. E. absurd, wollte man das daran festmachen, daß gerade niemand diesen Satz aussprechen kann. Ich kann heute sagen: Eine Sekunde nach dem Urknall galt der Satz des Pythagoras. (Der Satz ist vielfach bewiesen, keiner der Beweise enthält ein Gültigkeitsdatum.) Dann soll eine Sekunde nach dem Urknall der Satz des Pythagoras keinen Sinn gehabt haben? Nur, weil ihn niemand formulieren konnte? Das ist für mich nicht logisch. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 19.02.2018 um 23.31 Uhr |
|
Von Pythagoras ist nicht bekannt, daß er diese Einschränkung (nach dem Urknall) gemacht hätte.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 20.02.2018 um 01.28 Uhr |
|
"nach dem Urknall" ist keine Einschränkung. "nur nach dem Urknall" wäre eine, die habe ich auch nicht gemacht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.02.2018 um 03.26 Uhr |
|
Es gibt hier etwas zu entmystifizieren. Ein Satz, den gerade niemand formuliert – das ist wohl der Kern des Problems. Was tut der Wind, wenn er gerade nicht weht? Oder weniger kindlich und ernsthaft diskutiert: Glaubt ein Christ auch im Schlaf an Gott? Kann der Aphatiker eigentlich sprechen – wenn er doch nach einer Erholungsphase wieder ganz normal sprechen kann, muß das Können nicht die ganze Zeit dagewesen sein? (Kompetenz war da; nur Perfomanz ließ zu wünschen übrig.) Auch vor Milliarden Jahren war die Wirklichkeit so, wie der Satz des Pythagoras (UNSER HEUTIGER SATZ) es darstellt. Das ist nicht dieselbe Aussage wie "Der Satz galt schon damals". Nach dem Urknall galt schon der Satz, daß Beethoven genau 32 Klaviersonaten komponieren würde, nicht wahr? Und unendlich viele andere Sätze, das kann man beweisen. Man kann es aber auch lassen. Meine These war: Der Satz, den wir durch Verstellung/Vormachen aus dem wirklichen Gesprächszusammenhang herauspräparieren, ist kein ideales Gebilde in einem intelligiblen Reich, sondern ein menschliches Konstrukt. Die vorgetragenen Sophismen sind nicht mehr als das, sinnlose Spielereien. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.02.2018 um 04.20 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1507#37862 Nur zur Erinnerung: Ich habe hier, dem Thema entsprechend, das Verstellungsspiel auf das lehrende Vormachen eingeschränkt. Eine andere Funktionalisierung habe ich an einer anderen Stelle erwähnt, an die man auch immer denken sollte: Verstellung als Kern von "gespielter Nichtkooperativität" in Rätsel, Metapher, Ironie: http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1546 |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 20.02.2018 um 07.09 Uhr |
|
Wir reden vielleicht aufgrund einer begrifflichen Kollision aneinander vorbei. Der Satz über Beethovens Sonaten ist kein Naturgesetz und war vor Beethoven weder bekannt noch beweisbar. Mathematiker benutzen oft das Wort Satz als Name für eine mathematische Tatsache. Sie haben dabei gar gar kein Interesse an der Versprachlichung. So könnte z. B. der "Satz des Pythagoras" auch die "pythagoreische Identität" oder ganz ohne Bezug auf den Entdecker(?) "Seitenidentität rechtwinkliger Dreiecke" heißen. Namen sind Schall und Rauch, es wäre nur ein anderer Name für die Tatsache aa+bb=cc. "Der Satz galt schon damals" bedeutet also für einen Mathematiker das gleiche wie "Die Identität (der Sachverhalt) galt schon damals" und ist wiederum das gleiche wie der Hinweis, daß die damalige Wirklichkeit so war, wie wir sie heute mit dem Satz des P. beschreiben. Vielleicht illustriert es ein anderes Beispiel besser: Gab es vor Milliarden Jahren schon Zahlen? Gab es vor dem Menschen, als noch niemand gezählt hat, schon die Zahl zwei? "Existiert" die Zahl zwei eigentlich heute? Mathematiker sagen, es "gibt" bzw. es "existiert" genau eine gerade Primzahl. Ich meine, in diesem Sinne "existierten" Zahlen und galt die "Seitenidentität" in rechtwinkligen Dreiecken (auch Satz des P. genannt) auch schon, bevor der Mensch alles entdeckte. Mit der Bezeichnung "Satz" meint der Mathematiker keine sprachliche Struktur, sondern einfach eine mathematische Tatsache. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.02.2018 um 07.59 Uhr |
|
Wir kommen immer wieder auf den Sonderfall Mathematik zurück, wo der Streit um die Natur ihres Gegenstandes nie beigelegt werden wird. Man denke an Kroneckers bekannten Satz. Was soll man dazu sagen? Mir fällt nichts weiter ein. Aber daß Sachverhalte und ihre sprachliche Darstellung (also etwas Zeichenhaftes, Kommunikativers) ganz unvergleichbar sind, daran halte ich fest.
|
Kommentar von R. M., verfaßt am 20.02.2018 um 08.36 Uhr |
|
Galt der Satz des Pythagoras also schon vor dem Urknall?
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 20.02.2018 um 10.10 Uhr |
|
Wir wissen nicht, ob "vor dem Urknall" überhaupt ein sinnvoller Ausdruck ist, d.h. ob es so eine Zeit überhaupt gibt, und wenn ja, ob die Welt zu diser Zeit genauso determiniert war und die gleichen logischen Gesetze galten. Auch die Zeit genau am Urknall ist so etwas wie durch Null dividieren. Um allen Wenns und Spekulationen aus dem Weg zu gehen, habe ich aus der zeitunabhängigen Gültigkeit in dieser Welt wenigstens geschlossen, daß der mathematische Sachverhalt zum Beispiel auch schon seit einer Sekunde nach dem Urknall so gegolten haben muß. Das sollte aber keine zeitliche Einschränkung der allgemeinen pythagoreischen Regel bedeuten.
|
Kommentar von R. M., verfaßt am 20.02.2018 um 12.17 Uhr |
|
Pythagoras wußte nichts von einem Urknall. Mag sein, daß er die Gültigkeit seines Satzes für die Zeit seit Erschaffung der Welt angenommen hat, aber darüber wissen wir nichts. Wir nehmen heute an, daß es einen Urknall gegeben hat, wissen aber nichts über die Zeit davor, sofern es eine Zeit davor gegeben hat. Einverstanden?
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 20.02.2018 um 13.47 Uhr |
|
Ja, natürlich. Die ganze Urknalldiskussion gehört sowieso nicht hierher, ich habe doch nur etwas pointiert eine Zeit weit vor der Existenz der ersten Menschen nennen wollen. Pythagoras hat bei seiner Erkenntnis sicherlich überhaupt nicht an eine bestimmte Zeit gedacht, ist ja aus mathematischer Sicht auch nicht nötig.
|
Kommentar von R. M., verfaßt am 20.02.2018 um 16.40 Uhr |
|
Die Sache ist insofern von Belang, als sie zeigt, daß selbst der Satz des Pythagoras nicht völlig unabhängig von den Bedingtheiten menschlicher Erkenntnis aufgefaßt werden kann.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.02.2018 um 18.08 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1507#37516 Um es also ganz deutlich zu sagen: "Mimesis" bedeutet in der Ästhetik nicht "Nachahmung", sondern geradezu im Gegenteil "Vormachen". Wer den König Ödipus mimt, macht ihn nicht nach, sondern vor. Das liegt so sehr auf der Hand, daß ich mir nicht vorstellen kann, es habe noch keiner bemerkt. Das ist kein Streit um Worte, sondern nur so wird es möglich, die darstellende Kunst an die Theorie der Verstellung anzuschließen. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 21.02.2018 um 21.13 Uhr |
|
Wenn man einen bestimmten Zweck verfolgt, mag es dienlicher sein, Mimesis als Vormachen zu verstehen. Es handelt sich m. E. um die zwei Seiten einer Medaille, jenachdem klopft man an die Tür oder an der Tür, und rechts ist da, wo der Daumen links ist. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.02.2018 um 21.33 Uhr |
|
Wieso denn das?
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 21.02.2018 um 22.41 Uhr |
|
Ich dachte, das läge auf der Hand. Um König Ödipus zu mimen, muß man etwas tun, was ihm nachgesagt wird (vielleicht das ungefähre Aussehen, Kleidung, Gestik, typische Worte kopieren, alles soweit bekannt). Das, was der Schauspieler dem Ödipus nachmacht, macht er dem Publikum vor.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 22.02.2018 um 01.58 Uhr |
|
Falls die Legende um Ödipus nicht auf Tatsachen beruhen sollte, wäre das Nachmachen natürlich gegenstandslos.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.02.2018 um 05.23 Uhr |
|
Was ein Künstler darstellt, muß es weder in der Wirklichkeit noch in der Legende (Überlieferung) gegeben haben. Das ist schlicht irrelevant. "Fiktion" wäre auch treffend, wie man ja auch von nach englischem Vorbild von fiktionaler Literatur spricht. Es wäre doch weit hergeholt, wollte man Handlung und Personen von "Hamlet" als Nachahmung bezeichnen. Auf einer anderen Ebene liegt der Unterschied zwischen mimetischer und diegetischer Literatur (Platon, Aristoteles). "Viel lügen die Dichter." – Alle, ob Stückeschreiber oder Erzähler, produzieren Fiktion, Mimesis eben. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.02.2018 um 09.03 Uhr |
|
Ich nehme also bis auf weiteres an, daß das Vormachen oder Vorführen ein Derivat des Verstellungsspiels ist, während die Nachahmung etwas Eigenständiges und ganz anderer Herkunft ist. Wenn diese Hypothese einigermaßen zutrifft, dann sind Vormachen und Nachmachen nicht zwei Seiten derselben Medaille. Für das Naturalisierungsprojekt (die evolutionäre und geschichtliche Erklärung der Sprache) scheint mir das schon ziemlich wichtig zu sein.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.02.2018 um 05.59 Uhr |
|
Folgende Ableitungen des Verstellungsspiels sind bekannt: Rollenspiel Theatralisches Aufführen vor Publikum Direkte Rede Täuschung, Lüge, Heuchelei Rätsel, Metapher, Ironie, Prüfungsfrage (allesamt gespielte Nichtkooperativität) Lehrendes Vormachen, Vorsagen und Einsagen (Soufflieren) Versetzte Rede (Tempus, Modus, Nebensatz) Üben (teilweise) Was noch? Theoretisch könnte Nachahmung als Verstellung aufgefaßt werden (so tun, als sei man der andere), aber empirisch spricht einiges dagegen. Beim Kind treten die beiden Verhaltensweisen unabhängig von einander zu verschiedenen Zeiten auf. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.03.2018 um 08.51 Uhr |
|
Noch zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1507#37870 Jemand könnte mit dem Bild eines Menschen in Boxhaltung herumgehen und zu einem sagen: "So mußt du es machen!", zu einem anderen: "So habe ich es gemacht", und weiter: "So darfst du es nicht machen", "Wenn du es doch so machen würdest", "Hätte er es so gemacht", "Er wird es so machen" usw. Das wären also der identische Kern und die unterschiedlichen funktionalen Einbettungen (aus denen man die Momentaufnahme kunstvoll herausgelöst hat, denn die wirklichen Vorkommen sind immer die eingebetteten). So dann auch die identischen Satzradikale und dazu die mysteriösen "propositionalen Einstellungen". Letztere müssen entmystifiziert werden, und das geschieht durch den Nachweis der verschiedenen "Geschichten", in die die Proposition eingebettet ist. Die Möglichkeit, einen solchen Kern herauszupräparieren, beruht auf unserer Fähigkeit zu Verstellungsverhalten, denn einen Satz außerhalb jeder wirklichen Verwendung vorzuführen (zu zitieren), ist die Fähigkeit zum Tun-als-ob, also Verstellung (Vormachen, wie bereits dargelegt). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.03.2018 um 17.20 Uhr |
|
Die sachgemäße Beziehung von Vorstellung und Verstellung habe ich, wenn ich mich recht erinnere, bisher nur bei Ryle gefunden: Sich etwas vorstellen ist nicht wie in einem Kino sitzen und auf eine Leinwand gucken, sondern es ist "prätendierte Wahrnehmung". Man verhält sich in gewisser Hinsicht (aber nicht in jeder!) so, als nähme man etwas wahr. Und das kann man lernen, wenn die Fähigkeit des Verstellungsspiels überhaupt gegeben ist.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.07.2018 um 15.39 Uhr |
|
Viele Spezies spielen. Aber nur Menschen betreiben Regelspiele, und nur Menschen spielen Fantasie- oder Als-ob-Spiele. (Rakoczy/Tomasello) Wissen wir das? Ein Lebewesen, das nicht spricht, kann keine Regeln aufstellen. Jedenfalls können wir nie sicher sein, daß sein Verhalten "Regeln" folgt, was immer das bei sprachlosen Organismen heißen könnte. Über die Fantasie von Tieren wissen wir auch nichts, und Verstellungsspiele spielen viele von ihnen sehr oft (simuliertes Jagen, Fangen, Beißen...). Die vermeintliche Besonderheit des Menschen läuft also wieder mal auf die Sprache hinaus. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.10.2018 um 06.17 Uhr |
|
Die Zeitung berichtet über die Kultur des Nüsseknackens bei Schimpansen, die in einzelnen Gruppen vor allem von den Weibchen „weitergegeben“ werde. (Wieder wird auf Christophe Boesch verwiesen, siehe Haupteintrag.) Schimpansen stellen in beschränktem Umfang auch Werkzeug her (Zweige zum Termitenangeln herrichten). Es wird zugegeben, daß sie bis zu zehn Jahren brauchen, bevor sie das Nüsseknacken etwa mit einem Stein beherrschen, und daß ihnen das Nachahmen schwerfällt. (Man legt heute Wert darauf, mechanisches Nachmachen von einem funktional verstandenen zu unterscheiden.) Aber Schimpansen geben ihre Tradition nicht weiter, weil sie nicht vormachen, daher nicht lehren. Statt von weitergeben sollte man von weiternehmen sprechen. Darum dauert es auch so lange. Die anekdotischen Belege für Lehren sind inzwischen fast 30 Jahre alt und anscheinend nicht wesentlich vermehrt worden. Lehren durch Vormachen ist eine Spezialform des Verstellungsspiels. Man tut so, als knacke man eine Nuß, und dazu gehört auch, daß man sich vergewissert, ob und wie gut der Lehrling es schon kann, und sich dann wieder entsprechend verhält. Darauf beruht der ganze menschliche Fortschritt, auch die Beherrschung einer Sprache. (Übrigens: Affen sollen eine Zeichensprache lernen, aber zum Nüsseknacken zehn Jahre brauchen – nach manchen Autoren gar zwanzig Jahre?) Einige Autoren wollen auch nicht von Nachahmung sprechen, sondern eher von stimulus enhancement o. ä. (s. o. zu Emulation). – Junge Affen, deren Mütter Nüsse knacken, beschäftigen sich ebenfalls mit den herumliegenden Nüssen und Steinen und kommen allmählich von selbst auf das Knacken, aber es kann lange dauern. So haben auch die englischen Meisen das Öffnen von Milchflaschen gelernt. (Ich wiederhole mich, aber das tun die Primatenforscher auch, wie man gerade wieder sieht.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.12.2018 um 06.34 Uhr |
|
Robert Spaemann ist gestorben, die FAZ (Patrick Bahners) widmet ihm einen ziemlich verklausulierten Nachruf (de mortuis...). Mich interessiert er eigentlich nicht, aber wegen seines "Gottesbeweises aus der Grammatik" habe ich ihn hier erwähnt und wird er uns lieb und teuer bleiben. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.12.2018 um 04.14 Uhr |
|
Spaemann bekannte zwar, kein Biologe zu sein, was ihn aber nicht hinderte, über Biologie zu sprechen. Für ihn war Konrad Lorenz mit seinen „Fulgurationen“ der Stand der Forschung, er hielt die Annahme zielgerichteter Mutationen für notwendig. Die „Innerlichkeit“ als letzte Bastion des nicht naturwissenschaftlich Erklärbaren, Intentionalität als eine Lorenzsche Fulguration usw. Die einfältigeren Formen des Kreationismus lehnte er ab, aber nur diese. – Das ist alles ebenso naiv wie sein Gottesbeweis. (Interview im Handelsblatt 8.9.2007) |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 13.12.2018 um 12.01 Uhr |
|
Spaemanns vermeintlicher Beweis beruht darauf, wie er selbst schreibt, daß Wahrheit (und Vernunft) Gott voraussetzten. Sein Futurum exactum usw. ist nur ein effektvolles Aufblasen dieser Annahme. Er hätte statt dessen Gott mit Wahrheit gleichsetzen sollen, aber das war ihm zu atheistisch.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.03.2019 um 05.56 Uhr |
|
Die Weitergabe kultureller Fertigkeiten geschieht weitgehend zweigleisig: durch Rituale und Artefakte. Der Meister zeigt dem Lehrling, wie man Steine abschlägt, aber daneben liegen auch die fertigen Faustkeile als Muster. Ebenso das Schnitzen und die Schnitzerei, das Malen und das Bild. Der kleine Chinese lernt, wie man Tusche reibt und den Pinsel hält; aber die fertigen Kalligraphien gibt es auch. Das Kind findet heraus und übt, wie man Legosteine zusammensteckt; es orientiert sich zunächst nicht an schon vorhandenen Konstruktionen. Das kommt später, auch ein "Reengineering". Die Enkelin (1;10) steckt Lego zusammen und bringt an einer Ecke noch ein dysfunktionales Rad an, nennt das Ganze Auto. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.03.2020 um 05.32 Uhr |
|
Die Zitatform eines Zeichens ist nicht dessen „Name“. Katze ist nicht der Name des Wortes Katze, sondern dieses selbst im Modus des Vormachens, also der Verstellung (pretending). Man tut so, als ob man es gebrauche, aber die „Kontingenzen“ des Gebrauchs (die verschiedenen Ursachen oder steuernden Reize des Gebrauchs) fehlen, es ist nur ein Spielverhalten. Das Vorführen (Simulieren) ist etwas ganz anderes als das Benennen. Beim Benennen wird kategorisiert, beim Vormachen gerade nicht. Bei einigen Aphasieformen fallen Gebrauchen und Zitieren deutlich auseinander, wie besonders Kurt Goldstein untersucht hat. Es sind grundverschiedene Aufgaben. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.04.2020 um 18.17 Uhr |
|
Susan Blackmore: When we read a story and then tell it to someone else is this imitation? I would say that it is. The skills involved may be far more complex than the kinds of imitation I have described above, but they have a basis in imitation and are of the same general form. Something about the story is internalised in the listener and then reproduced when she or he tells the story again. The same can be said of passing on religious or scientific ideas - the reader or hearer of the ideas must internalise them in some way and then reproduce them for another reader or listener. Hier ist unsere Unwissenheit in den vagen Ausdruck "internalised in some way" verpackt. Blackmore vertritt und propagiert bekanntlich die Mem-Theorie und kann sich auch auf ein beiläufiges Zitat von Dawkins stützen, wenn sie Meme als imitierte Verhaltenseinheiten definiert. Das ist ein bißchen verwunderlich, denn sie kennt sehr wohl andere Wege der Weitergabe (Konditionierung). Aber zurück zur Nachahmung: Ich könnte zum Beispiel die Geschichte von Odysseus erzählen, aber wieso wäre das ein Fall von Nachahmung? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.06.2020 um 05.58 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1507#24391 (letzter Absatz) Manchmal ahmen Kiinder auch unwesentliche, irrelevante, funktionslose Einzelheiten der Vorlage nach. Dies wird als "Überimitation" (overimitation) untersucht. Man sollte aber bedenken, daß es nicht der erklärungsbedürftige Sonderfall ist, sondern daß man sich umgekehrt darüber wundern sollte, daß Zweijährige schon imstande sind, ein beobachtetes Verhalten in seinen funktionalen Zusammenhang einzuordnen. Overimitation wird bei Zweijährigen beobachtet, nicht bei Menschenaffen (Thomas Suddendorf), anscheinend bei Hunden (Ludwig Huber). Die Literatur ist nur teilweise brauchbar, weil meistens in mentalistischer Begrifflichkeit abgefaßt. Vormachen und Nachmachen ist das menschliche Verfahren der Weitergabe von Fertigkeiten schlechthin. Darum verdient auch die Überimitation Beachtung. Wie schon berichtet, glauben kleine Kinder manchmal, daß man bestimmte Wörter in einer bestimmten Tonlage aussprechen muß, z. B. "ja" ganz dunkel. So haben sie es zufällig gehört. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.06.2020 um 11.18 Uhr |
|
The thesis of this book is that what makes us different is our ability to imitate. (Susan Blackmore: The Meme Machine. Oxford 1999:3) Auch Tiere ahmen nach, aber nur Menschen machen vor. Aber "modeling" ist nicht mal ein Stichwort. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.07.2020 um 17.35 Uhr |
|
Zur Differenzierung eines naiven Nachahmungsbegriffs, die heute stark diskutiert wird, gibt es recht frühe Zeugnisse: Seit Millionen und Abermillionen von Jahren gähnen Fische, Lurche, Kriechtiere und Vögel, aber erst bei den Säugetieren – und nur bei einigen Gruppen darunter – wurde es „ansteckend". Erst sie „nahmen es wahr", wurden davon „affiziert", obwohl doch die ganze Wirbeltierreihe vor ihnen es immer schon beim Artgenossen gesehen hatte! Wenn ein Karpfen einen anderen gähnen sieht, so ändert er sein Verhalten deshalb nicht. Sieht ein Mensch einen anderen herzhaft gähnen, und ist er selbst auch nur etwas abgespannt oder müde, so gähnt er fast zwangsweise mit. Ist es beim Menschen also Ausdruck, beim Karpfen aber nicht? Wenn der Mensch nach einem langen Gang durch den Zoo in das Halbdunkel des Aquariums tritt und der Karpfen ihn angähnt, so gähnt er auch mit, oft jedenfalls, oder er verspürt doch einen Drang dazu. Ist das Gähnen des Karpfens jetzt Ausdruck? Ist endlich der Mensch schon sehr abgespannt, so braucht der Fisch gar nicht wirklich zu gähnen: Schon der Anblick seines großen, in rhythmischen Atembewegungen auf und zu gehenden Maules reicht hin, um den Menschen gähnen zu machen. Von Ausdruck kann hier keine Rede mehr sein, aber ein „Eindruck" entsteht und löst eine ihm, nicht der Situation adäquate Reaktion aus! (Paul Leyhausen: Biologie von Ausdruck und Eindruck. Psychologische Forschung 31, 1967:113-176, S.128) Köhler (1921a) beschreibt die „Mitbewegungen", die ein Schimpanse ausführte, als er einen anderen im Nachbarkäfig Kisten unter der aufgehängten Banane auftürmen sah. Ähnliches kann man leicht bei Kindern im Kasperltheater oder auch bei Sportlern beobachten. Bei all diesen Bewegungen handelt es sich nicht etwa um Nachahmung, sondern einfach um die mimisch und pantomimisch oft übertriebene Ausführung von Bewegungen oder Teilen davon, die man ausführen würde, wenn man selbst in der Situation wäre oder nur an das Objekt herankönnte. (ebd. S.146) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.08.2020 um 16.13 Uhr |
|
Menschen lehren und lernen typischerweise durch Vormachen und Nachahmen. Der Fremdsprachenlehrer spricht am besten vor; durch bloße Beschreibung ist die fremde Sprache nur schwer zu vermitteln. Dagegen bringt der Dompteur dem Löwen durch Shaping (selektive Belohnung sukzessiver Annäherung) bei, durch einen Reifen zu springen. Er springt nicht selbst hindurch. Das scheinen mir recht gute Beispiele zu sein, um sich den wichtigen Unterschied klarzumachen. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 25.08.2020 um 17.37 Uhr |
|
Stimmt, Vormachen und Nachahmen eignen sich besonders gut bei der Vermittlung von Sprachen oder von praktischen Fertigkeiten (z. B. handwerkliche Tätigkeiten, Kochen, Turnen u. ä.). Aber es muß auch noch etwas anderes geben, z. B. scheint mir, daß naturwissenschaftliche Zusammenhänge kaum durch Vormachen/Nachahmen zu erlernen sind, sondern durch Erklären/Mitdenken und theoretisches Verständnis.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.08.2020 um 04.21 Uhr |
|
Zur Nachahmung noch was Amüsantes, was viele aus ihrer eigenen Erfahrung kennen werden: Im Vorwort zu Susan Blackmores "Meme machine" erzählt Richard Dawkins: As an undergraduate I was chatting to a friend in the Balliol College lunch queue. He regarded me with increasingly quizzical amusement, then asked: "Have you just been with Peter Brunet?" I had indeed, though I couldn´t guess how he knew. Peter Brunet was our much loved tutor, and I had come hotfoot from a tutorial hour with him. "I thought so", my friend laughed. "You are talking just like him; your voice sounds exactly like his." I had, if only briefly, "inherited" intonations and manners of speech from an admired, and now greatly missed, teacher. Das ist natürlich dasselbe wie: Wie er räuspert und wie er spuckt, Das habt Ihr ihm glücklich abgeguckt. (Wallensteins Lager) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.09.2020 um 17.27 Uhr |
|
Unbekannte Schriftzeichen kann man nicht abschreiben, nur abmalen. Dabei kommt es – aus der Sicht des Beobachters, der die Schrift kennt – zu Überimitationen. Jeder "Zufallsschnörkel" wird wiedergegeben, auch wenn er nicht funktional ist. Aber bitte sehr; die bekannte chinesische Standardschrift gibt auch noch die zufälligen Eigenheiten der Pinselschrift wieder; Verdickungen, An- und Absetzen des Pinsels usw., ganz abgesehen von den allgemeinen Zügen wie Bevorzugung von eckigen gegenüber runden Strichen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.10.2020 um 07.02 Uhr |
|
Unser Schönschreiben (das gab es bei uns in der Grundschule) dient, wie auch Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Kalligrafie) feststellt, der Lesbarkeit der Buchstaben, während die eigentliche Kalligraphie im chinesischen Kulturkreis und die arabisch-islamische die Lesbarkeit herabsetzt: „Schriftstile wie die Grasschrift stellen den eigentlichen Text und seine Lesbarkeit sogar bewusst hinter die kalligraphische Gestaltung zurück, selbst gebildete Chinesen können Grasschriften oft nicht lesen. Sie gelten als Bild, nicht als Text.“ Auf chinesischen Bildern stehen gewöhnlich mehr oder weniger umfangreiche Texte, so auch auf den Rollbildern, die ein chinesischer Maler meiner Frau und mir gewidmet hat. In unseren Kunstmuseen muß man lange suchen, bis man ein Bild findet, das irgendwie beschriftet ist. Das deutet ebenfalls auf ein verschiedenes Verständnis von Schrift hin. Im islamischen Kulturkreis kommt das Bilderverbot hinzu. Es wird mit dem Monotheismus in einen nicht ganz überzeugenden Zusammenhang gebracht. Man muß auch unterscheiden zwischen den Geboten bzw. Verboten des auf fremde Götter "eifersüchtigen" Gottes im AT und der allgemeineren Abbildungsscheu, die der Benennungsscheu des Sprachtabus entspricht. Sowohl die Benennung als auch die Abbildung beschwört den Gegenstand selbst herauf, und den kann man verehren oder ängstlich meiden (vgl. das zweideutige lat. "sacer"). Die gleiche magische Auffassung kann also dazu führen, daß man Götter und Göttliches exzessiv darstellt oder ganz und gar nicht, in der Sprache entsprechend wieder und wieder anruft oder niemals beim Namen nennt. (Aufs banalste wiederholt sich diese Spaltung im politisch korrekten Sprachgebrauch: z. B. Frauen entweder nie oder ständig erwähnen.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.11.2020 um 05.50 Uhr |
|
Wie schon gesagt, fällt auf, daß unsere Vorfahren z. B. Faustkeile über enorme Zeiträume immer genau gleich hergestellt haben. Die Faustkeile des Acheuléen, die über Jahrhunderttausende Homo ergaster / Homo erectus zugeschrieben werden, wurden rund 1,5 Millionen Jahre lang im gesamten Verbreitungsgebiet nach dem immer gleichen Muster hergestellt. Kleinere regionale Varianten können auf das jeweils unterschiedliche Ausgangsgestein zurückgeführt werden, sie gelten daher nicht als Beleg für intentionale Änderungen. (Wikipedia Faustkeil) Daß die Steinabschläge von Kapuzineraffen immer gleich bleiben, ist nicht schwer zu erklären. Aber die Frühmenschen hatten eine Kultur, d. h. sie haben die Kunst der Werkzeugherstellung weitergegeben, sie war "intentional", wie der Eintrag es naiv nennt. Sollten den Menschen über diese ungeheuren Zeiträume keine Verbesserungen eingefallen oder "unterlaufen" sein? Später kam es ja dann dazu, und zwar mit buchstäblich durchschlagendem Erfolg. Ich nehme also an, daß das Handwerk durch sozialen Zwang normiert war und keine Abweichung geduldet wurde. Wenn es später doch zu Abweichungen und damit auch Verbesserungen kam, könnte eine veränderte Sozialstruktur vorgelegen haben, etwa größere Gruppen mit mehr Vielfalt und auch Konkurrenz. Sprache dürfte immer dabeigewesen sein. Das sind Phantasien und Spekulationen, aber die Paläontolgen machen auch nichts anderes. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.11.2020 um 06.00 Uhr |
|
Wenn man etwas übt, dann beobachtet man wie ein Fremder seinen eigenen Körper, der es immer besser kann. Man weiß nicht, wie es zugeht, es ist nicht „intentional“, nur die Umstände, die man arrangiert, sind willkürlich. Das eigentliche Lernen, die Verhaltensänderung, bleibt unwillkürlich. Erlebter Dualismus: ich und mein Körper. Ein Musiklehrer kann dem Schüler beibringen, nicht den nächstliegenden Fingersatz zu wählen, sondern einen, der auf den ersten Blick schwieriger scheint, auf die Dauer aber günstiger ist. So der Fingerwechsel auf derselben Taste, etwa Scarlatti K 141 ist ohne Fingerwechsel gar nicht möglich (https://www.youtube.com/watch?v=Gh9WX7TKfkI). Eine ähnliche Weisheit steckt in allen handwerklichen Fertigkeiten, die in ordentlicher Lehre weitergegeben werden. In solchen Fällen liegt „Versuch und Irrtum“ in der Geschichte; das Leben des einzelnen ist zu kurz, um von selbst darauf zu kommen. Der eigentliche Grund muß weder dem Lehrer noch dem Schüler bewußt sein, früher halfen Arbeitslieder und -verse manchmal, die Fertigkeit zu stabilisieren, und das ist eine frühe und elementare Funktion der Sprache. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.11.2020 um 16.54 Uhr |
|
Die Lehre von den "propositionalen Einstellungen" ist abzulehnen, aber bevor ich mich auf die logischen und philosophischen Theorien einlasse, in denen sie aufgekommen ist, will ich auf die noch sonderbarere Reduktionsform hinweisen, die sie unter Linguisten angenommen hat. Hans Altmann zum Beispiel schreibt an vielen Stellen seit Jahrzehnten so etwas: Mit einem Aussage-Satz kann eine propositionale Einstellung ausgedrückt werden, die man etwa mit ´sagen/mitteilen, daß´ umschreiben kann. Wie bitte? sagen ist ein redeeinleitendes Verb und drückt keine "Einstellung" aus, auch nicht in den traditionellen logischen Texten, wo es um wünschen, fürchten usw. geht. Auch fragen und weitere solche Verba dicendi zählt Altmann auf. Niemand scheint daran Anstoß zu nehmen. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 27.12.2020 um 18.28 Uhr |
|
Unsere Enkelin, 4 1/2, hat zu Weihnachten ein Arztspiel bekommen und läuft nun herum, jeden zu untersuchen. Als sie unserm Sohn das Stethoskop ansetzt, erklärt er ihr: "Du mußt sagen, bitte tief einatmen!" Sie: "Bitte tief einatmen!" Er, betont bis zum Anschlag: "Hhhhhhhhhh." Sie, horchend: "Noch tiefer!" |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.12.2020 um 07.19 Uhr |
|
Das kommt in meine Sammlung. Zur Zeit ist ja Impfen angesagt, in jeder Tagesschau sieht man gefühlt zehnmal, wie die Nadel in den Oberarm gleitet. Wirkt das eigentlich beruhigend oder abschreckend? Es gibt Menschen, die schon beim Sprechen über so etwas in Ohnmacht fallen, wärend es anderen gar nichts ausmacht. Leider kann man den Kindern keine "invasiven" Arztspiele nahebringen, sonst könnten sie schon mal üben. Eine mir sehr nahestehende Person weiß in Notfällen, was zu tun ist, und tut es einfach, packt zu, tröstet usw. Aber wenn sie darüber spricht, kommen ihr leicht die Tränen. Mir selbst machen ärztliche Maßnahmen nichts aus, aber als mir eine nette Ärztin erklärte, was sie und ihr Chef bei einer bevorstehenden Operation (mit dem Da-Vinci-Roboter) zu tun gedachten, wurde mir schwummerig, und ich mußte mich kurz hinlegen. Das ist kein Einzelfall, scheint aber noch wenig erforscht zu sein. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.06.2021 um 07.57 Uhr |
|
Die Kindersprache "entwickelt sich" nicht, sondern wird stückweise und oft ruckartig angeeignet. Die Enkelin (4;2) fängt an: Als ich ein Kind war, war ich in Erlangen. (Sie ist vor einem halben Jahr in einen Vorort gezogen.) So hat sie es oft von ihrer Mutter gehört: als ich ein Kind war = früher. Sie erklärt ein Bild, auf dem die Katzenmutter ihr Junges im Maul trägt: Die beißt nicht, die bringt ihr Baby nur in Sicherheit. in Sicherheit bringen ist als Ganzes nachgeahmt und durchkreuzt gewissermaßen den systematischen Aufbau des Wortschatzes. Übrigens scheint der Tragegriff, bei dem Katzen bekanntlich in Tragstarre fallen, mit dem Nackenbiß zusammenzufallen, mit dem der Kater sämtlicher Feliden das Weibchen beim Kopulieren ruhigstellt. Ein Fall von Exaptation (Umfunktionierung). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.07.2021 um 04.53 Uhr |
|
Zu den schon mehremals erwähnten Arbeitsliedern, die Gruppenleistungen vom Typ 1 (nach Hofstätter) synchronisieren: Dickens erwähnt ein Arbeitslied der Schmiede (Great expectations, Kap. 12), das vollständig so lautet: Hammer boys round – Old Clem! With a thump and a sound – Old Clem! Beat it out, beat it out – Old Clem! With a clink for the stout – Old Clem! Blow the fire, blow the fire – Old Clem! Roaring dryer, soaring higher – Old Clem! (St. Clement ist der Schutzpatron der Schmiede.) Aus der Schmiede stammt auch das ebenfalls hier schon besprochene Up high, down low, Up quick, down slow – And that’s the way to blow. (Blasebalg) Die Anleitung ist verbunden mit der Rhythmisierung. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.08.2021 um 06.09 Uhr |
|
Wenn Tiere sich gleich verhalten und diese Angleichung sich ausbreitet, ist man versucht, von Nachahmen und Vormachen zu sprechen. Nachahmung wäre leichter von äußerlich ähnlichem Verhalten zu unterscheiden, wenn der Nachahmende ab und zu innehielte und auf das Modell blickte, um sich der Einzelheiten zu vergewissern. So hält es der Mensch. Es ist dem nachahmenden Tier jedoch egal, wie gut es schon nachahmt – wie es dem Modell egal ist, wie gut es nachgeahmt wird. In beiden Fällen fehlt die Rückkoppelung. Darum sprechen wir ja bei Tieren nicht von Vormachen, wenn sie etwas vorher machen. Als entscheidende Grundlage und wichtiges Beispiel für soziales Lernen ist Nachahmungslernen auch eine essentielle Voraussetzung für die Entstehung und Entwicklung von Kultur. Das zeigte bei Japanmakaken z.B. die Ausbreitung des Kartoffelwaschens im Meer, das ein einzelner Affe erfand. Gruppenmitglieder haben es abgeschaut, und obwohl die erste Generation der Kartoffelwascher bereits gestorben ist, hält die Tradition noch heute an. Die Vereinzeltheit dieser Episode als Beispiel von Kulturbildung fällt zu selten auf. Was könnte sich nicht alles in vielen tausend Jahren an Traditionen angehäuft haben! Aber ausgerechnet zu unseren Lebzeiten hat sich das Kartoffelwaschen entwickelt und sonst nichts. Das läßt Zweifel aufkommen, ob die Geschichte und ihre Deutung stimmen. |
Kommentar von , verfaßt am 11.08.2021 um 05.10 Uhr |
|
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.08.2021 um 06.42 Uhr |
|
Hat man versucht, Tieren (Affen) das Lehren durch Vormachen – und das Lehren dieses Lehrens – beizubringen? (Unterweisung durch Sprache kommt nicht in Frage.) Ist Traditionsbildung konditionierbar? Einmal in die Welt gesetzt, könnte sie Bestand haben. Das Nachmachen des Vorgemachten müßte sukzessive durch den Erfolg verstärkt werden, entweder selbstverstärkend (Lernen am Erfolg) oder durch Belohnung (shaping). Ist die Traditionsbildung (Kultur) einmal in die Welt gekommen und nie wieder verlorengegangen, oder kann sie aufgrund der biologischen Ausstattung jederzeit entstehen? (Dieselbe Frage wie zum Sprachursprung.) Das Experiment könnte sich mit kleinsten Erfolgen begnügen. Auch die Kultur der frühmenschlichen Arten war sehr bescheiden. Faustkeile herstellen, Feuer machen und unterhalten – das ist vielleicht schon verhältnismäßig spät gegenüber Techniken, die keine Spuren hinterlassen haben: Eßbares finden, Fische fangen, Beutetieren auflauern, Schutz suchen... Das ist natürlich nur eine Träumerei, ich glaube nicht, daß man damit Erfolg haben könnte. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.08.2021 um 06.35 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1507#37867 Ich hätte hier noch einen zweiten Fehler erwähnen können: Lola, renn! ist ein ungeeignetes Beispiel, weil es sich eigentlich um zwei Sätze handelt, die folglich kein gemeinsames Satzradikal enthalten können. Lola ist nicht Subjekt, sondern eine satzwertige Anrede. Nach Skinners schon erwähnter Analyse könnte man das Ganze als konditionales Gefüge umschreiben: "Wenn du Lola bist, renn!" Von hier aus läßt sich aber die Frege-Wittgensteinsche Theorie der Satzradikale (= Propositionen) nicht rekonstruieren. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.08.2021 um 05.35 Uhr |
|
Wenn man als Silberrücken die weisen Augen über die spielenden Kinder gleiten läßt, wird einem ganz schwindlig ob der vielen überflüssigen Bewegungen. Sie gehen grundsätzlich nicht, sondern rennen, und sie sprechen keine ordentliche Prosa, sondern jodeln über mehrere Oktaven, wie es scheint. Das ist ja alles sehr schön, aber man kommt sich doch recht alt vor. Solche Anwandlungen beiseite, kann man an Kindern viel Freude haben. Der Enkelin zuzusehen, wie die kleinen Finger die Legosteine zusammenfügen oder sonst etwas Kniffliges üben, ist immer wieder ein Grund zum Staunen und Freuen, sozusagen stellvertretende Funktionslust (Bühler). Wenn Kinder etwas tun, erfahren sie zwangsläufig, daß es bei jeder Wiederholung besser gelingt. Wird das Verhalten von seiner primären Funktion gelöst und nur noch wegen der Verbesserung ausgeführt, handelt es sich um Üben. Es ist also definitionsgemäß eine Form von Verstellung. Das Üben ist oft in der Musikpädagogik untersucht worden, außerdem an Sporthochschulen. Wer ein Instrument übt, wird durch den Genuß des gelungenen Spiels belohnt. Das spielt er dann gleich noch mal und kann es dadurch immer besser. Wiederholung wird gelernt, weil sie ihr Ergebnis verbessert. Ein kleines Mädchen, das erst vor kurzem laufen gelernt hat, klettert immer wieder zwei steinerne Stufen auf dem Spielplatz hinauf und hinunter, bis sie es wirklich mit Leichtigkeit schafft. Es kommt ihm also nicht darauf an, auf dem oberen Absatz zu sein; sonst würde es sich mit einmaligem Emporklimmen begnügen. Andererseits zieht es aus einem anfänglichen Scheitern nicht die Folgerung „Ich kann das nicht“, sondern vertraut auf die Möglichkeit der Verbesserung. Das Üben kann zu einer allgemeinen Gewohnheit werden, weil es in den verschiedensten Lebenslagen nützlich ist. Der Grundsatz der Montessori-Pädagogik „Hilf mir, es selbst zu tun“ beruht auf dieser Einsicht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.08.2021 um 05.55 Uhr |
|
Nachtrag: Die Menschen unterscheiden sich schon als Kinder darin, daß die einen gleich die Flinte ins Korn werfen, wenn etwas mißlingt, während die anderen dranbleiben, bis sie es können. Manchmal berichten die Zeitungen über extreme Beispiele, so etwa den Mann, der in vorgerückten Jahren anfing, Klavier zu lernen, und tatsächlich sein Ziel erreichte, Liszts „Campanella“ zu spielen. Als wir neulich mit der Bahn an unseren Urlaubsort zu kommen versuchten, mußte ich daran denken, wie oft Minister Scheuer oder einer seiner Vorgänger mich schon in diese pädagogisch wertvolle Situation gebracht hatte: aufgeben oder es doch noch versuchen? Meine Frau ist entschieden für letzteres. Einmal war eigentlich schon alles verloren, da geriet sie versehentlich in einen Sonderzug mit Fußballfans, der natürlich nicht im Fahrplan vorgesehen war, und erwischte dadurch – unter freundlichem Beistand der heiteren Zeitgenossen – einen Bummelzug, durch den sie wiederum den eigentlich angestrebten ICE auf einem Bahnhof, wo er auf dem gegenüberliegenden Gleis eine Minute zu lange hielt, doch noch abfangen konnte, so daß wir am Ende glücklich wiedervereint waren. Also niemals aufgeben! (Der Verkehrsminister bleibt ja, unter welchem Namen auch immer, Wahlen hin oder her. Er wird immer ein Mann des Autos sein, wie der Landwirtschaftsminister ein Vertreter der Bauernlobby.) |
Kommentar von Stephan Fleischhauer, verfaßt am 29.08.2021 um 11.38 Uhr |
|
https://deutschlandfunknova.de/beitrag/nachwuchsfoerderung-pornos-fuer-affen Eben dran vorbeigesurft und mußte gleich an diesen Thread denken. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.08.2021 um 05.14 Uhr |
|
Zur Kalligraphie (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1507#44557) Man könnte die Kalligraphie mit dem Handicap-Prinzip erklären: Ich kann es mir leisten, die Schrift schwerer lesbar zu machen. Aber das ist sicher nicht alles. Bei den Chinesen gewinnt die Schrift ein ästhetisches Eigenleben, und wenn wir Koransuren in arabischer Kalligraphie sehen, nehmen wir mit Recht an, daß die Kunst der besonderen Ehrung der heiligen Texte dient. In meiner Jugend habe ich (wie viele andere) bestimmte Gedichte, die mir besonders gefielen, in meiner schönsten Schrift in ein besonders schönes Heft geschrieben. Warum eigentlich? Es ist ein etwas hilfloser Versuch, sich etwas Geliebtes anzueignen. |
Kommentar von Stephan Fleischhauer, verfaßt am 30.08.2021 um 07.23 Uhr |
|
In unserem Kulturkreis gibt es auch schwer lesbare Formen von Kalligraphie. https://i.otto.de/i/otto/b5080067-59d2-5d2c-a32c-a1ccf2ca9f6d |
Kommentar von Erich Virch, verfaßt am 30.08.2021 um 09.48 Uhr |
|
Der Wunsch, sich etwas Geliebtes anzueignen, äußert sich auch im Nachsingen und Mitsingen von Liedern. Da beben ganze Fußballstadien.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 06.09.2021 um 17.08 Uhr |
|
Eine unsrer Enkelinnen wird Ende dieses Monats zwei. Es ist immer wieder schön zu beobachten, wie sie sprechen lernen. Ich zeigte ihr einen kurzen Zeichentrickfilm zu "Alle meine Entchen" aus dem Internet. Sehr hübsch gemacht, die Entchen im See, Täubchen auf dem Dach, und bei der Zeile "sind sie alle froh" hüpfen die Hühnchen im Stroh auf und ab. Meine Enkelin kommentierte die hüpfenden Hühnchen spontan mit "Häschen hüpf". |
Kommentar von Stephan Fleischhauer, verfaßt am 22.09.2021 um 00.14 Uhr |
|
Interessantes Video, in dem ein Schimpanse einen Menschen anleitet, wie Futter überreicht werden soll. https://youtube.com/watch?v=SG8d52cVG_E |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.11.2021 um 17.21 Uhr |
|
Das bedruckt mich nicht ein. (Enkelin 4;7) Die Verbzusatzkonstruktion beherrscht sie wie alle Kinder längst, aber hier hat sie ein bißchen falsch segmentiert. Das Verb gehört natürlich nicht zu ihrem aktiven Wortschatz, der ist aber wie üblich mit Erwachsenen-Phrasen durchsprenkelt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.11.2021 um 06.39 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1507#46987 Habe ich es nicht gesagt? Das Verkehrsministerium soll an die FDP gehen! |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.03.2022 um 16.53 Uhr |
|
Zum „Homo docens“: Beim Manipulieren von Gegenständen und überhaupt bei Bewegungen registrieren wir den Erfolg jedes einzelnen Verhaltensschrittes und korrigieren danach unser Verhalten. Das gleiche gilt, wenn wir jemandem etwas beibringen: Wir kontrollieren, wie weit er uns schon nachahmt oder wie weit er etwas verstanden hat (wiederholen oder paraphrasieren kann). Auch Tiere richten ihr Verhalten nach einer solchen Rückkopplungsschleife ein (TOTE nach Miller et al.). Aber zum Lehren kommt es nicht. Warum nicht? Vielleicht weil es zu risikoreich wäre, wenn der Nachwuchs etwas anders macht, als es ererbt ist? Ich nehme an, daß dem Vormachen das noch elementarere Verstellungsspiel zugrunde liegt. Wer etwas vormacht, tut es nicht wirklich (funktional), sondern im „entspannten Feld“ des Spiels, wo es nicht um die Selbsterhaltung geht. Warum kommt es bei Tieren nicht dazu? Hat man mit bildgebenden Verfahren nach dem Sitz der Paraphrasenfähigkeit gesucht? Wie kommen wir dazu, zweierlei für ein und dasselbe zu halten (oder für äquivalent)? Zwei verschiedene Sätze sind doch wohl auch nach ihrem Ort im Hirnscan verschieden – wieso werden sie als äquivalent behandelt? Welche Regionen sind gegebenenfalls für spielerische Verstellung zuständig? Die Aphasieforschung stellt getrennte Störbarkeit des funktionalen und des fiktionalen Sprachverhaltens fest: Ein Wort nur aussprechen oder vorführen, zitieren („metasprachlich“, wie man sagt, aber das Wesentliche ist die Verstellung) und ein Wort kommunikativ verwenden ist zweierlei. |
Kommentar von , verfaßt am 02.03.2022 um 05.21 Uhr |
|
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.03.2022 um 05.49 Uhr |
|
Für die alten Römer gab es keinen schlimmeren Vorwurf, als rerum novarum cupidus zu sein. Die Abneigung gegen alles Neue (mRNA-Impfstoffe, alternative Energie) ist ja heute noch zu spüren. Es geht einher mit ausdrücklichem „Lob des Bewährten“, des mos maiorum. |
Kommentar von Stephan Fleischhauer, verfaßt am 02.03.2022 um 10.00 Uhr |
|
Gendersprache fehlt noch in der Aufzählung.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.03.2022 um 13.31 Uhr |
|
Ich würde eher sagen: Gleichstellung der Geschlechter, also vor allem Gleichberechtigung der Frau – das ist wirklich etwas Neues. Das Gendern ist bloß ein Irrweg dorthin, so etwas zählt nicht.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.04.2022 um 19.32 Uhr |
|
Ich hatte hier die frühe Kritik von Hermann von Helmholtz am industriell hergestellten Kinderspielzeug erwähnt, anderswo auch die Kritik des erstaunten H. L. Mencken. Nachdem Ernst Mach die forschende Tätigkeit der „unermüdlichen Finger“ kleiner Kinder beschrieben hat, fügt er in einer Fußnote hinzu: „Jedes Spielzeug, vor allem das moderne Luxusspielzeug, wirkt zweifellos entwicklungshemmend und hat eine verhängnisvolle, decadente Unbeholfenheit im Gefolge.“ (Ernst Mach: Kultur und Mechanik. Stuttgart 1915:24 [Nachdruck Frankfurt 2015]) Natürlich werden solche Bedenken heute noch weniger beachtet, zumal die Pädagogik-Professoren, die es erforschen müßten, nach meiner Erfahrung oft als "Gutachter" wirken, die dem Industriespielzeug ihr Gütesiegel aufdrücken. (Die gleiche sanfte Korruption wie bei den Medienpädagogen, die Fernsehen für Zweijährige entwickeln und empfehlen.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.10.2022 um 06.06 Uhr |
|
Noch jedes Kind, dessen Entwicklung ich beobachten konnte, hat zu einer gewissen Zeit eine unbezwingbare Lust am Aussprechen unanständiger Wörter (pipikakascheißepups). Die Erwachsenen sprechen ordnungsgemäß ihren Tadel aus, wissen aber, daß sich das auswächst. Der spielerische Verstoß gegen eine Norm festigt diese, wie überall.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.11.2022 um 04.36 Uhr |
|
„Bei Löwen und zahlreichen anderen Arten müssen die Eltern den Jungen das Jagen beibringen.“ (Jared Diamond: Der dritte Schimpanse. Frankfurt 2007:88) Wirklich? Das wäre aber sehr unsicher. Das Jagdverhalten der Löwen ist aber – allenfalls bis auf geringe lokale Unterschiede – vollkommen gleichartig, nur das Jagdgeschick nimmt auf natürliche Weise mit dem Alter zu. Das ist ebenso wie bei der Geschicklichkeit von Affen beim Nüsseknacken usw. „Junglöwen gehen im Alter von drei Monaten zum ersten Mal mit der Mutter zur Jagd. Erst im Alter von zwei Jahren haben sie die Jagdkunst so weit erlernt, dass sie nicht mehr von Alttieren abhängig sind.“ (Wikipedia Löwe) Angeborenes und nach und nach am Erfolg gelerntes Verhalten reichen aus; es gibt keine Belege für eine Unterweisung durch die Elterntiere. Sie machen das Jagen nicht vor und werden nicht nachgeahmt, und andere Formen der Unterweisung kommen nicht in Betracht. Auf diese Weise kann die „Jagdkunst“ nicht verlorengehen wie bei uns manche Kunst durch schlechten Schulunterricht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.01.2023 um 04.45 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1507#46590 Wenn ich den Waldarbeitern zusehe, die ja gerade jetzt besonders mit Holzfällen beschäftigt sind, denke ich an die mutmaßliche Herkunft von hau ruck!, das die "Gruppenleistung" des Holzrückens synchronisiert – eine der ältesten Funktionen der Sprache (wie Arbeitslieder). Man spricht noch heute von Rückewegen und Rückepferden. Letztere sind kaum noch im Einsatz, obwohl sie den Waldboden schonen, der durch die modernen Maschinen verdichtet wird. Die Arbeiter fällen Bäume, die der Förster zuvor geschalmt hat – auch dieses Wort kennen viele Menschen nicht mehr. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.04.2023 um 18.21 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1507#43741 Thomas Suddendorf (Der Unterschied S. 244ff.) berichtet von Experimenten, die zeigen, daß Kinder etwa bem Öffnen einer Puzzle-Box überimitieren, Affen aber nicht. Das beweist meiner Ansicht nach, daß die Affen gar nicht imitieren, sondern angeregt durch den lehrenden Menschen funktional vorgehen, d. h. das Problem unter Sachsteuerung eigenständig lösen, nicht wie es ihnen gezeigt wurde, sondern wie sie es auch sonst tun würden, während die Kinder wirklich übernehmen, was der Lehrende ihnen vorgemacht hat. Gerade die Unzweckmäßigkeit ist der Beweis. Zuerst wird die Topographie des Musters nachgebildet, später wird die Funktion davon abgetrennt. Die kulturelle Akkumulation beruht wohl auf der Fähigkeit zur formgetreuen Nachahmung. Wer ein Problem auf die gleiche Weise löst, wie er es schon imer getan hat, kommt zwar schnell ans Ziel, aber dabei bleibt es dann auch. Überimitation scheint also auf den ersen Blick ziemlich töricht, auf den zweiten aber weiterführend. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.04.2023 um 05.36 Uhr |
|
Die Enkelin (1;4) hält sich das Telefon ans Ohr und simuliert einen halben Dialog: unverständliche Silben (sie spricht ja noch nicht), es klingt aber vernünftig, und sie läßt Pausen für die imaginäre Rede des anderen. Dabei geht sie über den Flur ins Bad, wie um nicht gehört zu werden oder niemanden zu stören. Das hat sie ihrer Mutter abgeschaut, die meistens das gleiche tut: beim Telefonieren geht man ins Nebenzimmer. Die Genauigkeit der Imitation wirkt bei einem so kleinen Kind fast unheimlich.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.06.2023 um 12.31 Uhr |
|
Dawkins hat im Zusammenhang mit seiner Religionskritik nach Gründen gesucht, warum Kinder sich die religiösen Vorstellungen ihrer Eltern zu eigen machen. Er sieht darin einen Sonderfall der allgemeineren Bereitschaft, alles zu glauben, was die Eltern sagen, und diese Bereitschaft hält er für genetisch seligiert: Es ist überlebenswichtig, nicht alle Erfahrungen selbst machen zu müssen, sondern von den Erfahrungen der Älteren zu profitieren. Aber daß die Kinder genau das lernen, was die Alten sie lehren, ist kein erklärungsbedürftiges Phänomen, sondern im Begriff des Lernens und Lehrens enthalten: Der Lehrende läßt nicht ab, bevor der Lernende das angestrebte Verhalten zeigt. Wenn das Kind Buchstaben malt, gilt das Lernen erst dann als abgeschlossen, wenn die normgerechte Form erreicht ist. Ebenso das Benehmen bei Tisch usw. Ein Märchen ist dann verstanden, wenn das Kind es nacherzählen kann. Erklärungsbedürftig ist also nicht das Verhalten der Kinder (was bleibt ihnen anderes übrig?), sondern das der Eltern (warum bestehen sie auf exakter Übernahme?). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.06.2023 um 04.09 Uhr |
|
Zum Haupteintrag: Emulation ist heute nicht nur in der EDV, wie Duden angibt, die vorherrschende Form. Früher war das direkt aus dem Lateinischen, also ohne englische Vermittlung übernommene Ämulation durchaus üblich. Diese Bildungstradition ist für weite Kreise abgebrochen, man entlehnt ein zweites Mal. Das ist so ähnlich bei Programmierern, die vom Syntax (mask.) sprechen, weil sie das Wort bisher nicht kannten und der englischen Entlehnung ein neues Genus verpassen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.11.2023 um 13.53 Uhr |
|
Ich zeige der Enkelin (1;11), wie man Schneebeeren einen kleinen Knall entlocken kann, wenn man sie auf festen Boden legt und darauftritt. (Für das kräftige Schleudern mit noch besserem Effekt ist sie noch zu klein.) Zuerst traut sie sich nicht recht, dann tritt sie mit einem Fuß darauf und oft auch noch daneben, wobei sie sich an einer Hand festhalten läßt, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Der Tritt wird immer sicherer, das Festhalten bald überflüssig. (Sie hat damit durch Nachahmung oder von selbst gelernt, daß es besser ist, nur kurz mit der Sohle auf die Beere zu tippen, als sich mit dem ganzen Gewicht daraufzustellen; das ist aber schon ein weiterer Fortschritt im Gleichgewichthalten. – Einige Minuten Mikrolernen, wie es sich in aller Stille jeden Tag abspielt und eine allgemeine Geschicklichkeit erzeugt. Sie hat soviel Spaß an der neuen Entdeckung, daß sie keine Ruhe gibt, bis wir die Sträucher fast ganz abgeerntet haben. (Die Schneebeeren sind ja allgegenwärtig, nicht nur in Gärten und Parks, eigentlich aber amerikanische Exophyten.)
|
Kommentar von Wolfram Metz, verfaßt am 15.11.2023 um 23.44 Uhr |
|
Neulich habe ich hier in einem Drogeriemarkt beobachtet, wie ein kleiner Junge – er mag vier Jahre alt gewesen sein – seinem Vater hinterhertrottete und wieder und wieder fast verzweifelt fragte: »Waarom?« Wenn ich es mir richtig zusammengereimt habe, wollte der Kleine, daß der Vater irgend etwas für ihn kauft, ein Spielzeug, eine Süßigkeit, was auch immer – man kennt das ja. Für uns Erwachsene ist das Fragen nach dem Grund normal, aber irgendwann müssen wir das gelernt haben. Wie man Unmut äußert (schreien, heulen, mit den Armen zappeln), wissen wir schon sehr früh. Woher? Ist es angeboren? Aber warum kommt es einem kleinen Kind in den Sinn, nach dem Grund für eine ihm nicht genehme Entscheidung zu fragen? Der Vater ist darauf nicht eingegangen und hat immer nur den Kopf geschüttelt, was der Junge zutreffend als Bekräftigung des zuvor offenbar explizit ausgesprochenen Neins interpretierte. Ich habe mich dann gefragt, wie der Knirps wohl reagiert hätte, wenn der Vater ihm tatsächlich einen Grund genannt hätte. Hätte er die Antwort des Vaters überhaupt rhetorisch verwerten können, so wie Erwachsene das in solchen Situationen zu tun versuchen? Oder hätte er, wie es das Klischee verlangt, die erste, die zweite und jede weitere Antwort immer wieder mit einem »Waarom« quittiert? Daß die Antwort Material für eine Schlacht liefert, die man am Ende doch noch gewinnen könnte, muß wohl auch erst gelernt werden, im nächsten Schritt. Bis dahin steht das mechanisch wiederholte Aussprechen des Wortes »waarom« für sich. Das Ganze erinnerte mich an eine Begebenheit aus meiner Kindheit. Ich hatte immer wieder beobachtet, wie meine Mutter mit einem feuchten Tuch die Brotkrümel von der Küchenarbeitsplatte entfernte. Einmal wollte ich ihr helfen, schnappte mir das Tuch, vollzog mit der Hand die Bewegungen, die sonst sie machte, und schüttelte danach das Tuch über der Arbeitsfläche aus, vielleicht habe ich die Krümel auch mit dem Tuch an den Rand der Platte und dann auf den Boden befördert, ich weiß es nicht mehr. Meine Mutter lachte jedenfalls und zeigte mir, wie es richtig geht. Ihre Handbewegungen auf der Platte hatte ich perfekt nachgeahmt, nur hatte ich nicht begriffen, daß sie dazu dienten, die Krümel zusammenzuschieben, und daß man sie dann mit dem Tuch aufnimmt, um sie schließlich sicher im Mülleimer zu entsorgen. Um beim ersten Beispiel zu bleiben: Es beginnt damit, daß das Kind ein Wort nachspricht, nachdem es beobachtet hat, wie andere es aussprechen. Irgendwann nimmt es darüber hinaus ein bestimmtes Verhaltensmuster wahr, in diesem Fall, daß jemand einen anderen nach dem Grund für dessen Verhalten, hier Ablehnung der geäußerten Bitte, fragt. Als nächstes lernt es, daß man der gegebenen Antwort widersprechen kann, dann, wie man ihr am besten widerspricht, um beim anderen eine Verhaltensänderung zu bewirken. Und so weiter und so fort. Wenn man das weiterspinnt, wäre das Leben eine unendliche Abfolge von Nachahmungen. Wobei man nicht nur, im herkömmlichen Sinne, andere nachahmen kann, sondern auch sich selbst – je älter man wird, um so mehr. Bleibt da überhaupt noch Raum für »eigenständige« intellektuelle Leistungen, für Erfindungen, für das Hervorbringen von wirklich Neuem? Woher weiß der Mensch, wie er in einer bestimmten Situation argumentieren muß, um seine Interessen am besten zu wahren? Woher weiß er überhaupt, was seine Interessen sind? Vielleicht ist auch das alles das Ergebnis von unendlich vielen Analogien und daran geknüpften Nachahmungen? Gerade fiel mir auf, daß »Analogien« im vorigen Satz wohl nicht ganz passend ist, und binnen weniger Sekunden »bildete« ich das Wort »Analogieerfahrungen«. Auch nicht besser, aber solche Komposita kenne ich natürlich aus der oft gewichtig daherkommenden Philosophensprache. Könnte also passen. Auch eine Form der Nachahmung. Mir schwirrt der Kopf, ich gehe ins Bett. Das tagtägliche Kopieren dieses meines Verhaltens verbinde ich mit einer angenehmen Vorstellung. Mal sehen, was ich morgen früh als erstes denken werde. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.01.2024 um 05.32 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1507#44920 Die Enkelin (genau 2 Jahre alt) stöpselt sich das Stethoskop aus ihrem Arztkoffer in die Ohren und horcht jeden Anwesenden ab; dabei stellt sie stets die Diagnose Besser!, appliziert aber dennoch eine „Spritze“ und „Salbe“. Natürlich weiß sie, daß alles nur ein Spiel ist. Psychologen deuten solche Spiele (besonders auch nachgespielte Kindergarten- und Schulszenen) als Versuche, schwierige Situationen zu bewältigen. Jedenfalls ist es spezifisch menschlich. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.01.2024 um 05.26 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1507#43474 Ich halte es nicht für sinnvoll, den Begriff der Nachahmung so weit auszudehnen wie Susan Blackmore. Wenn ich die Abenteuer des Odysseus erzähle, nachdem ich sie gelesen oder auch nur in einer Verfilmung gesehen habe, ist das keine Nachahmung in einem brauchbaren Sinn. Sonst wäre es Nachahmung, wenn jemand Arzt wird, weil sein Vater Arzt war, oder wenn ich eine halbe Stunde später meiner Frau auf demselben Weg folge, auf dem sie vorausgegangen ist. Sonst würden Tiere, von denen feststeht, daß sie nicht nachahmen, unablässig nachahmen, auch Ameisen, die einander folgen. Damit ginge eine wichtige Unterscheidung verloren. Ich kann ein Objekt kopieren, das als Muster gegeben ist. Ich kann ein Objekt nach einer Konstruktionszeichnung (Blaupause) bauen. Dabei findet die Übertragung in ein anderes Medium statt (Transkription nach Skinner). Ich kann ein Objekt nach einer sprachlichen Anleitung (Rezept) konstruieren. Aus dem fertigen Objekt kann die Anleitung nicht mehr rekonstruiert werden (Dawkins). (Es gibt Übergänge und Mischformen.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.01.2024 um 06.31 Uhr |
|
Wenn die Enkelin (1;8) beim Öffnen der Gartentür rückwärts geht, macht sie "biep, biep", und ich komme erst nach einer Weile darauf, daß sie damit die rückwärts fahrenden Müll- und Baustellenwagen nachahmt. Es ist immer wieder überraschend, was Kinder beobachten. Die Sechsjährige will genauer wissen, wie die Planeten um die Sonne kreisen, und wundert sich darüber, daß die Sonne ein Stern sein soll, die anderen Sterne aber auch Sonnen sind. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.03.2024 um 08.20 Uhr |
|
Die Enkelin (2;2) steht vor dem Klavier und tut so, als spiele sie nach Noten – in Wirklichkeit den goldenen Buchstaben des Markennamens „Grotrian-Steinweg“, die sie mit dem Finger nachfährt. Dann fordert sie die Oma auf, ein Liederbuch aufzustellen. Darin regen nicht die Bilder oder Noten, sondern der Text sie an, das Lied zu singen („Auf einem Baum ein Kuckuck saß...“). Drei Wochen später: Sie ahnt wirklich, daß nicht die Bilder, sondern die Buchstaben in einem Buch das Wesentliche sind, woraus die Erwachsenen die schönen Geschichten gewinnen. Sie hat mein Rechtschreibwörterbuch auf dem Schoß und singt daraus „Happy birthday to you“, wobei sie den Takt in die Hände klatscht. Ihr Cousin (2;11) sieht sich das Video an und kommentiert: "to lou, richtig englisch." Er hat noch Probleme mit manchen Konsonanten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.03.2024 um 05.30 Uhr |
|
Nele (2;3) springt immer wieder von der Couchlehne, nachdem sie „Lieber nicht!“ gerufen hat.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.05.2024 um 07.37 Uhr |
|
Woher die Zweijährige ihre Ausdrücke hat, war überschaubar, bis sie in die Krippe aufgenommen wurde. Jetzt überrascht sie ihren Vater mit der Ermahnung: „Kein Blödsinn machen!“ und ähnlichem, was zu Hause nicht üblich ist. Im übrigen sind viele Artikulationen noch recht schwach konturiert und am ehesten für die Eltern verständlich. Eine schwierige Frage ist, ob die kindliche Rede als „Altersmundart“ ihr eigenes phonologisches System hat oder ob das System der Erwachsenensprache zugrunde liegt und nur nicht vollkommen realisiert wird oder ob schließlich die Annäherung erst allmählich stattfindet und die gegenwärtigen Versuche wie eine Art akustische Malerei analogisch verfährt und nur einige „Inseln“ perfekter Artikulation (wie eben „Blödsinn“ oder auch auch „Butterbrot“) als Vorgriffe eingestreut sind.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.06.2024 um 05.03 Uhr |
|
Nele (2;5) versteckt sich, und nach dem lauten Zählen des Suchers bis 10 tritt sie strahlend aus ihrem Versteck hervor. Das macht ihr große Freude. Es ist halt ein anderes Spiel, als die Erwachsenen es im Sinn haben... Die Logik des Versteckens, Wartens, Suchens ist ja auch ein bißchen kompliziert. Mentalisten würden eine rekursive Theorie des Geistes zur Erklärung heranziehen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.06.2024 um 05.11 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1507#26357 Tiere üben nicht. Dieser fundamentale Unterschied wird erstaunlich selten erwähnt. Immerhin: „There is no convincing evidence that they [sc. non-human primates] can systematically rehearse skills in order to refine them.“ (Merlin Donald in Maggie Tallerman/Kathleen R. Gibson, Hg.: The Oxford handbook of language evolution. Oxford 2012:181) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.06.2024 um 05.06 Uhr |
|
Zu vorigen: Vielleicht hat es einen gemeinsamen Grund, daß Tiere weder üben noch Gegenstände zentriert stapeln: Sie sind – umgangssprachlich ausgedrückt – mit dem augenblicklichen Erfolg zufrieden und nicht an der formalen Perfektion der Ausführung interessiert, die erst auf längere Sicht zum Erfolg führt. (Ich stelle hier meine eigenen Betrachtungen an, weil ich in der Literatur nichts dazu finde. Stattdessen jede Menge „Theorie des Geistes“ bei Affen usw.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.06.2024 um 09.37 Uhr |
|
Nachdem wir den Kindern jahrelang Märchen erzählt und uns an ihren Verstellungsspielen beteiligt haben, sollen sie plötzlich „immer die Wahrheit sagen“. Wir selber lügen natürlich weiter, es geht gar nicht anders. Auch die normale Heuchelei als Höflichkeit usw. ist für das Zusammenleben unentbehrlich. Versäumnisse werden dissimuliert und belasten dann nicht weiter. Man kann weder immer lügen noch gar nicht lügen – beides würde, sofern logisch überhaupt möglich, die Gesellschaft zerstören. Eine reifere Sicht ist diese: Die Lüge und das Verbot der Lüge bilden zusammen ein großes Spiel. Nach Kant würde die Lüge in jedem Fall die Kommunikation und damit die menschliche Gemeinschaft zerstören, aber in Wirklichkeit macht sie sie erst möglich, weil Sprache ohne Verstellung nicht möglich ist. Wäre Verstellung von Anfang an ausgeschlossen gewesen, hätte sie nicht als uneigentliche Rede eine Zweitnutzung erfahren können. Für Kinder ist eine schöne Geschichte wahr. Manchmal beharren sie darauf, uns die abenteuerlichsten Bären aufzubinden, so daß wir nicht wissen, ob sie es ernst meinen oder uns auf den Arm nehmen wollen – diese Unterscheidung gilt für sie noch gar nicht. Ebenso gehört zu dem, was man sagt, auch das, was man nicht sagt. Das Schickliche wäre nicht schicklich, wenn es sich nicht vom Unschicklichen abhöbe. Die wirkliche Rolle der Verstellung („Lüge im außermoralischen Sinn“) müßte noch untersucht werden. Der Zoologe Volker Sommer hat ein „Lob der Lüge“ veröffentlicht (über Mimikry usw.). Darin verstößt er jedoch um des populären Tons willen gegen seine in anderen Arbeiten eingehaltene kritische Haltung zu anthropomorphisierenden Tiergeschichten. Philosophisch orientiert er sich an Dennett. Die gesellschaftliche Disziplinierung und Nutzung des Verstellungsverhaltens ist noch nicht umfassend untersucht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.07.2024 um 09.54 Uhr |
|
Verstellungsverhalten ist von grundlegender Bedeutung für den Menschen. Seine Derivate bis hin zum Unterweisen, Üben, "Denken" machen den Menschen aus. Um so erstaunlicher, daß es fast nirgendwo als Stichwort auftaucht. Die wenigen Verweise bei Google betreffen meine eigenen Einträge hier. Auf diese Ehre würde ich gern verzichten.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 12.07.2024 um 23.01 Uhr |
|
Ich kann mir das Nichterwähnen der Verstellung nur so erklären, daß sie zwar von grundlegender Bedeutung ist, aber von anderen Wissenschaftlern anders genannt bzw. unter einem anderen Gesichtspunkt gesehen wird. Das Lehren, Unterweisen auf eine Verstellung, ein So-tun-als-ob zurückzuführen, ist zwar ein interessanter und mir auf den zweiten Blick auch einleuchtender Gedanke, aber andererseits eben nicht unbedingt völlig naheliegend für den ersten Blick. Andere nennen es vielleicht Weitergabe von Wissen. Wenn man Wissen und Vernunft als nicht objektiv existierende Konstrukte versteht, kann man Lehre wohl nur mit Verhalten erklären. Für mich wie gesagt auch nicht abwegig, aber das Wort Verhalten klingt mir immer nach einem gewissen Automatismus, der die menschliche Intelligenz nicht einbezieht. M. E. wird Verhalten von Wissen und Vernunft gesteuert, und daraus resultiert dann auch das vielfältige menschentypische Verstellen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.03.2025 um 16.17 Uhr |
|
Zur "Überimitation" noch zwei Beispiele aus meinen Aufzeichnungen zum Spracherwerb. Ein dreijähriges Mädchen sprach "kaputt" eine Zeitlang stets in einem übertrieben besorgten Ton aus. Ein anderes (3;2) sagt gern "okay!", und zwar im gleichen "leichten" Tonfall wie ihr Vater, der es ebenfalls oft verwendet. Ich kann das hier schwer beschreiben, aber es wirkt geradezu erheiternd, wie man sofort den Vater zu hören glaubt, nur eine Oktave höher. Wahrscheinlich kennen Sie ähnliche Fälle. Von Überimitation kann man sprechen, weil die Reproduktion über das funktional Notwendige hinausgeht.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.04.2025 um 06.16 Uhr |
|
Das frühkindliche Sprechen hat keinerlei Ähnlichkeit mit dem Bild, das die Kognitivisten und Nativisten davon entwerfen: Das Kind analysiert den eingehenden Lautstrom und wählt eine angeborene Grammatik aus, die ihn am besten beschreibt. (Ich vereinfache, aber darauf läuft es hinaus.) Vielmehr wirft es in die intensive Interaktion (Spielen usw.) versuchsweise einige Brocken hinein, die vom Erwachsenen wohlwollend als Sprache gedeutet und mit Erfolg belohnt werden. Die Dreijährige redet und erzählt gerne, aber es ist noch bei weitem nicht alles normgerecht. Richtig ist, daß sie kaum je explizit korrigiert wird. Die Annäherung an die Erwachsenensprache geschieht hauptsächlich durch Nachahmung – ein vom Behaviorismus vernachlässigtes Gebiet, was vielleicht an der Experimentalforschung mit Tieren liegt, die tatsächlich nicht nachahmen. Der Erfolg spielt eine große Rolle, aber „Shaping“ wie bei einer Dressur kommt beim Spracherwerb kaum vor. Das dürfte bei der Manipulation von Gegenständen anders sein, wo z. B. das Zunehmen der Geschicklichkeit mit Legosteinen buchstäblich beobachtet werden kann (Lernen am Erfolg).
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.04.2025 um 03.53 Uhr |
|
Die Dreijährige fotografiert vom Starnberger See aus die Alpen: „Sagt mal cheese, ihr Alpen.“
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.04.2025 um 04.03 Uhr |
|
Wir erklären der Enkelin (3;3), daß sie und wir in verschiedenen Dörfern wohnen, aber beide in einer „Ringstraße“. Sie: „Das ist ein Zufall.“ Sie hat sicher noch nicht den ganzen erwachsenensprachlichen Sinn des Ausdrucks begriffen, aber das ist ja mit allen Wörtern so. Spracherwerb ist immer ein Vorgriff, eine Hochstapelei; man lebt über seine Verhältnisse, aber die Verhältnisse werden schon folgen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.04.2025 um 08.04 Uhr |
|
Gerade die Wörter des peripheren Wortschatzes hat uns doch im allgemeinen niemand erklärt oder definiert, und sie kommen so selten vor, daß eine induktive Erschließung auch nicht naheliegt. Woher weiß ich also, was etwa "moros" oder "halkyonisch" bedeutet? Es müssen andere Gradienten sein, die im Kontext gerade diese hochspezifische Reaktion auslösen, so daß ein beliebiges Zeichen an genau dieser Stelle genau dies bedeuten muß. Das ist aber der normale Verlauf des Spracherwerbs: Das Kind sitzt nicht in einem Gehäuse und versucht den Code hinter den einlaufenden lochstreifenartigen Zeichenketten zu knacken (Chomskys Bild von der Sprache), sondern die Wörter highlighten Knotenpunkte in der Interaktion. Darum werden sie verstanden, auch wenn das Kind sie nicht versteht... |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.05.2025 um 08.07 Uhr |
|
Wie erwähnt, ist Merlin Donald einer der wenigen Anthropologen, die das Üben als spezifisch menschliches Verhalten überhaupt besprechen. (Ich hätte noch weitere Schriften von ihm anführen können. Donald legt Wert darauf, daß vorab die „Motorik“, also das wirkliche Verhalten Gegenstand der Evolution gewesen sein muß; aber er kommt dann doch auf das Kognitive, das meiner Ansicht nach unnötig ist.) Wenn wir nach Vorläufern suchen, die für das Üben exaptiert worden sein könnten, stoßen wir auf das Spiel. Es ist in ähnlichem Sinn „kreativ“ und ohne erkennbaren Zweck. Wer etwas übt, sei es Treppensteigen oder Klavierspielen, wird durch die Verbesserung der Ergebnisse sukzessive verstärkt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.05.2025 um 05.27 Uhr |
|
Zur üblichen Fehlübersetzung von "Mimesis" noch folgendes: „Die Pantomime (von altgriechisch παντόμῑμος pantómīmos, wörtlich „alles nachahmend“) ist eine Form der darstellenden Kunst.“ (Wikipedia) Die Übersetzung ist offensichtlich falsch, es müßte heißen: „alles darstellend“ bzw. „vorführend/vorspielend“. Übrigens ist das Paar "Geste – Gebärde" ein gutes Beispiel für neutralisierbare Opposition: „Das Wort Geste, das allgemein eine die Rede begleitende Gebärde bedeutet und um 1500 auf das Gesten machen [!] öffentlicher Spaßmacher erscheint, ist eine Entlehnung aus lateinisch gestus, das die Gebärden eines Schauspielers oder Redners umfasst.“ (Wikipedia „Gestik“) Man findet viele willkürliche, dem Sprachgebrauch nicht entsprechende Definitionen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.07.2025 um 07.27 Uhr |
|
Kinder lernen um das Alter von dreieinhalb Jahren herum das Schaukeln, ohne von außen angestoßen zu werden. Es ist gar nicht leicht zu beschreiben, was wir da intuitiv tun: Der Zeitpunkt der Schwerpunktverlagerung mit den Beinen muß genau abgepaßt werden. Wir bekommen ein „Gefühl“ dafür durch Feedback von den ersten Beinbewegungen, aber eben erst ab einem bestimmten Alter. Mit welchen anderen Fertigkeiten korreliert das in sinnvoller Weise? Das ist die interessante Frage, auf die ich keine Antworten finde. Übrigens haben viele Erwachsene den Eindruck und sagen es auch, daß sie die Bewegung gleichsam durch „Vorwärtsdrücken“ mit dem Oberkörper fördern, merken also nicht, daß es ausschließlich an den Beinen liegt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.10.2025 um 04.15 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1507#49754 usw. Kinder freuen sich über Sprachscherze, weil sie sich durch den spielerischen Normverstoß ihrer gerade erst erworbenen Normbeherrschung vergewissern. „Im sozialen Lachakt erfolgt die Rückversicherung der Ordnung.“ (Hermann Helmers: „Zur Entwicklung von Sprache und Humor“. In Ders., Hg.: Zur Sprache des Kindes. Darmstadt 1969:479-495, S. 482) „Das Kind um 2;6 kann auf eine abgelegte ‚Sprachhaut‘ zurückblicken.“ (Ebd. S. 484) |
