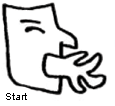
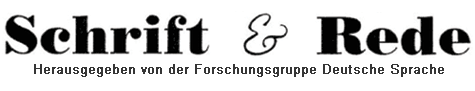

| Diskussionsforum | Archiv | Bücher & Aufsätze | Verschiedenes | Impressum |
Theodor Icklers Sprachtagebuch
Sie sehen die neuesten 12 Kommentare
Nach unten
Durch Anklicken des Themas gelangen Sie zu den jeweiligen Kommentaren.
Theodor Ickler zu »Trüber Morgen« |
|
Zum zehnjährigen Jubiläum der Monsanto-Übernahme hat Bayer nicht viel zu feiern. Jenseits der Krebsrisiko-Frage gibt es harte Tatsachen: Bayer hat für Monsanto 60 Mrd. Dollar gezahlt, die „größte Firmenübernahme der deutschen Geschichte“. Heute ist der ganze Konzern, einst der wertvollste Deutschlands, noch 50 Mrd. wert – wegen Monsanto. Wir Laien haben die außergewöhnliche Stupidität damals gesehen und aufgeschrieben. Mich haben immer die Folgen für die Böden mehr interessiert. Herr Achenbach hat hier mit Recht gefragt, ob die Ersatzstoffe nicht noch schädlicher sein könnten; die Frage ist heute sehr aktuell. Wir beobachten seit Jahrzehnten die hiesige Landwirtschaft. Maisfelder, deren glyphosatbedingte „Sauberkeit“ uns besonders auffiel, werden jetzt durch Gründüngung mit Ramtillkraut und Phacelia wiederaufgepäppelt. Die Möglichkeiten, auch ohne „Ersatzstoffe“ auszukommen, sind bestimmt noch nicht ausgeschöpft. Übrigens werden 60 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche für die Produktion von Tierfutter genutzt, der Mais zum Teil für Biogas. Der Gutachterstreit um Glyphosat ist aber gestern durch ein Machtwort beendet worden: „US-Präsident Donald Trump hat den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat als entscheidend für die nationale Sicherheit und die Lebensmittelsicherheit der USA eingestuft. Er unterschrieb eine Verordnung – eine sogenannte Executive Order –, die dem Mittel einen besonderen Status verleiht und vorgibt, dass eine ausreichende Produktion innerhalb der USA sichergestellt werden muss.“ (ZEIT 22.2.26) |
Theodor Ickler zu »Feucht und schmutzig« |
|
Unionsfraktionschef Jens Spahn hat eine Zusammenarbeit der CDU mit der Linken auf dem Bundesparteitag in Stuttgart erneut ausgeschlossen und dabei scharfe Kritik an der Partei geübt. (...) Die Berliner Linke bezeichnete er als "krude Mischung (…) aus alter SED und neuer Hamas". Zudem griff er die Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Heidi Reichinnek, persönlich an. "Ich kann euch sagen: Tattoos, TikTok, am Ende wird es mit Genossin Reichinnek nicht besser als mit Genosse Honecker", sagte Spahn. (t-online.de 22.2.6) Hoffentlich läßt sich Frau Reichinnek nicht dazu hinreißen, sich nun ihrerseits Spahns Privatleben vorzuknöpfen. |
Theodor Ickler zu »Jede und jeder« |
|
Vielen Dank für Ihre bewundernswerte Leistung, sich diesen „Leerlauf“ anzutun! So etwas „abzuspulen“ gilt ja in Deutschland als rhetorische Begabung. Das Gendern, die häufige Linksversetzung und das „und ja“ sind schon mal drei Signale, die bei mir „Abschalten!“ auslösen. Die Vorstellung, daß solche Nichtreden tatsächlich auch noch aufgeschrieben worden sind, macht mich schaudern. Jede KI könnte es besser. (Was man nicht sieht, ist die reformierte Rechtschreibung, ein weiteres Signal der sprachlichen Verkommenheit.) Wer etwas zu sagen hat, redet nicht so. Dieser Grundsatz hat sich bisher immer bewährt. Hinzu kommt ja noch, daß die „Freundinnen und Freunde“ bloß Parteifreunde sind, zur Hälfte also Feinde, weshalb die permanente Sexualisierung besonders abwegig klingt. Als bloßer Kontaktlaut wirkt sie indezent wie eine ständige körperliche Berührung: „Hiergeblieben!“ |
Wolfram Metz zu »Jede und jeder« |
|
Ich konnte es nicht lassen und habe gezählt. Merz bringt es fertig, in seiner 75minütigen Rede 58mal die Wortfolge »liebe Freundinnen und Freunde« abzuspulen, meist als Satzeinleitung oder mitten im Satz, in 9 Fällen nachklappend, wie von Herrn Virch beschrieben. Ein paarmal hat er nicht aufgepaßt: 7mal sagt er »liebe Freunde« und 2mal »liebe Freundinnen«. Die »Wählerinnen und Wähler« erwähnt er 5mal, 1mal sagt er nur »Wähler«, 1mal nur »Wählerinnen«, wobei aber immer Männer und Frauen gemeint sind. Er übertrifft sich selbst, wenn er die Anwesenden mit »liebe Delegierten und Delegierten« anspricht (Scholz läßt grüßen). Natürlich dürfen auch die Bürgerinnen und Bürger, Kolleginnen und Kollegen, Jüdinnen und Juden, Lehrerinnen und Lehrer, Wählerinnen und Wähler, Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht fehlen. Das einzige, was Merz beim Gendern noch von Gysi unterscheidet, ist die gelegentliche generische Verwendung männlicher Personenbezeichnungen im Plural, wie Amerikaner, Kritiker oder Zeitzeugen. Rhetorisch fallen besonders zwei Marotten auf, nämlich die Formel »Und ja, …« und Konstruktionen wie »Konrad Adenauer und mit ihm Ludwig Erhard, sie waren nicht nur die Gründungsväter unserer Republik […]«, »Das Fundament des Hauses Bundesrepublik Deutschland ist stark. […] Aber viele Stockwerke des Hauses, das auf diesem Fundament steht, sie sind sanierungsbedürftig« oder »Die gesetzliche Rentenversicherung, sie wird bleiben«. Die Wirkung solcher Herausstellungen verpufft, wenn sie inflationär gebraucht werden, was in Merz’ Rede der Fall ist. Sollte nicht eine rhetorische Figur möglichst gar nicht bemerkt werden, damit sie in der beabsichtigten Weise wirken kann? Ich sehe hier eine Parallele zum Gendern. Klug und maßvoll eingesetzt, kann es einen starken Effekt erzielen. Zwanghaft vollzogen, verursacht es jedesmal einen seltsamen Leerlauf im Gedankenfluß, der an der Ernsthaftigkeit des Redners zweifeln läßt. |
Theodor Ickler zu »Mal was zum Gähnen« |
|
Das habe ich auch schon erwogen, aber bisher sehe ich keinen Hinweis. Unabsichtliches Vormachen gibt es in meinem Sinn nicht. Zum lehrenden Vormachen gehört viel mehr als "vorher machen", wie ich anderswo schon ausgeführt habe. |
Manfred Riemer zu »Mal was zum Gähnen« |
|
Könnte es sein, daß er mit "Nachahmung" die Tätigkeiten des Vor- und Nachmachens einfach etwas zu lax zusammenfaßt? Vielleicht meint er damit, daß das Lernen nach beiden Methoden, aber eben ohne Sprache stattfand? Schließlich setzt Nachahmen ein Vormachen voraus, wenn auch nicht unbedingt absichtliches Vormachen. |
Theodor Ickler zu »Mal was zum Gähnen« |
|
Renfrew nennt die praktische Auseinandersetzung mit dem Material „(material) engagement“ und meint, handwerkliche Fertigkeiten wie die Herstellung von Steinwerkzeug könnten über lange Zeit sprachfrei durch Nachahmung erworben worden sein (Prehistory – the making of the human mind. London 2007:121). Das ist aber sehr unwahrscheinlich und widerspricht der Beobachtung, daß die Weitergabe solcher Kulturtechniken nirgendwo auf der Welt der bloßen Beobachtung und Nachahmung überlassen bleibt. Stets kommt Unterweisung hinzu, hauptsächlich durch Vormachen. Renfrew scheint den „homo docens“ völlig übersehen zu haben. Damit verliert aber sein Bild von der Mentalität des Frühmenschen etwas Entscheidendes: die soziale Fähigkeit des Unterweisens und das Interesse daran unterscheiden den Menschen bereits auf einer sehr frühen Stufe von seinen Verwandten. |
Theodor Ickler zu »Jede und jeder« |
|
"Bäuerinnenopfer" murkst die Metapher ab, weil es im Schach keine Bäuerinnen gibt (wie bei Wagner keine Beckmesserin). |
Theodor Ickler zu »Mal was zum Gähnen« |
|
Der berühmteste Vertreter einer „kognitiven“ Archäologie, Colin Renfrew, meint, daß der Mensch im Gegensatz zu anderen Tieren nicht nur einen praktischen Umgang mit den Dingen habe, sondern ein „kognitives“ Verhältnis, das durch Begriffe, Normen, Meinungen usw. geprägt sei (Prehistory – the making of the human mind. London 2007). Renfrew hat seine Methode „evolutionäre kognitive Archäologie“, aber auch „Neuroarchäologie“ genannt. Er kommt allerdings ohne neurologische Spekulation aus, hält aber, wie der Untertitel des genannten Werks andeutet, den „Geist“ für eine objektive Tatsache, deren Entstehung sich durch eine psychologische oder geisteswissenschaftliche Interpretation erforschen lasse. |
Theodor Ickler zu »Trüber Morgen« |
|
Der handverlesene Supreme Court hat nicht so entschieden, wie der Oberzöllner Trump es sich gewünscht hatte, muß sich daher als korrupt beschimpfen lassen. Korrupt ist er allerdings insofern, als das Minderheitsvotum von Trumps Lieblingsrichtern genau vorhersehbar war. Abgesehen von der juristischen Seite hat sich herausgestellt, daß trotz der enormen Zolleinnahmen (die nun möglicherweise zurückgezahlt werden müssen) das Haushaltsdefizit nicht wesentlich kleiner geworden ist. Auch hat man ausgerechnet, daß die amerikanischen Verbraucher 95 % der Kosten tragen. Natürlich – wer denn sonst. Das neue Zolldekret wirkt wie ein kopfloses Umsichschlagen. Trump weitet die immer schon gegebene Möglichkeit, per Dekret zu regieren, unermeßlich aus. Dem deutschen Beobachter klingen die Ohren („Notverordnung“). |
Theodor Ickler zu »Trüber Morgen« |
|
Wegen der Kommunalwahlen werden wir mit Parteiwerbung überschwemmt, aber hier auf dem Dorf wirkt das wie eine fremde Macht, es geht praktisch nur um die Mitbürger, die man fast alle wenigstens flüchtig kennt. Die Männer müssen Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr und möglichst auch des Sportvereins sein. Das ist die Minimalforderung. Auch was sie sonst noch zu ihren Gunsten anführen, hat nichts mit ihrer Partei zu tun. Parteilose gibt es allerdings auch nicht. Ich habe selbst ein wenig politische Erfahrung und bin weit davon entfernt, mich über den Betrieb lustig zu machen. Wir haben es ja hier mit den berühmten „Graswurzeln“ zu tun. Wir sehen auch an Mamdani, was entgegen dem großen Trend von Geld und Macht möglich ist. Das sage ich ohne Bewertung, nur als Beobachter. Die „strukturelle“ Geschichtsschreibung scheitert immer wieder an solchen unvorhersehbar auftretenden Gestalten. Trump selbst ist ja auch ein Mann, der als "Charismatiker" und nicht auf dem Parteiticket an die Macht gelangt ist. Er weiß instinktiv, daß Gestalten wie Mamdani oder Talarico ihm gefährlich werden können. |
Theodor Ickler zu »Trüber Morgen« |
|
Claudius Seidl macht sich in der SZ über den Verfall Harald Martensteins lustig, den ich allerdings schon immer für überschätzt gehalten habe. Allgemein gilt ja, daß Menschen im Alter dieselben sind wie schon immer, nur noch mehr so. Wer sich über ihren vermeintlichen Wandel wundert, ist selber schuld. Daran habe ich oft denken müssen, wenn jemand, den ich zu kennen glaubte, plötzlich auf der rechtsradikalen Seite auftauchte. (Das Umgekehrte kommt praktisch nie vor: Rechtssein hängt mit dem Nachlassen der Geisteskräfte zusammen: Pessimismus, Zynismus, "Realismus", Granteln bis ins Grab.) |
Zurück zur Übersicht | nach oben