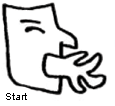


| Diskussionsforum | Archiv | Bücher & Aufsätze | Verschiedenes | Impressum |
Theodor Icklers Sprachtagebuch
12.10.2007
Mal was zum Gähnen
Was „Nature“ für mitteilenswert hält
In der Zeitung wird ein Bericht aus der neuesten Ausgabe der angesehenen Zeitschrift referiert:
"Je wichtiger ein Gen für seinen Organismus ist, desto weniger verändert es sich im Laufe der Zeit. Ähnliches gilt für unregelmäßige Verben, lässt eine Studie amerikanischer Mathematiker und Biologen vermuten. Zumindest im Englischen bleibt der unregelmäßige Charakter umso eher erhalten, je häufiger das jeweilige Verb benutzt wird."
Das ist seit Beginn der neueren Sprachwissenschaft allgemein bekannt, aber wenn es "amerikanische Mathematiker und Biologen" noch einmal herausgefunden haben, muß es wichtig sein. Übrigens hat auch der Pop-Linguist Steven Pinker von den unregelmäßigen Verben viel Aufhebens gemacht und wurde darob von Unwissenden als Wunder an Einsicht bestaunt.
| Kommentare zu »Mal was zum Gähnen« |
| Kommentar schreiben | neueste Kommentare zuoberst anzeigen | nach oben |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.10.2007 um 09.25 Uhr |
|
Für Interessierte: Es gibt schon lange die "Glottochronologie". Das ist ein Versuch, aufgrund einer empirischen ermittelten Veränderungsrate die Verzweigungspunkte in der Sprachentwicklung zu datieren. Hauptsächlich der Wortschatz wurde so untersucht ("Lexikostatistik"). Näheres unter diesen Stichwörtern. Als relativ stabil wurde natürlich der gemeinsame Kernwortschatz für Alltagsdinge, Körperteile usw. zugrunde gelegt. Die naheliegende Analogie zur biologischen Genetik ist jüngeren Datums. Zu Unrecht vergessen ist auch das Werk Franz Spechts, der formale Besonderheiten von Substantiven des "Nahbereichs" (Körperteile usw.) herausgearbeitet hat, also etwa Heteroklisie der Stammbildung. Die Unterscheidung von Nah- und Fernbereich ist in ihrer Bedeutsamkeit für die Sprache erst neuerdings wiederentdeckt worden, anscheinend ohne Kenntnis Spechts. Was die unregelmäßigen Verben betrifft, so ist seit langem bekannt, wie kleine Kinder damit umgehen: Zuerst sprechen sie die unregelmäßigen Formen nach, dann analogisieren sie sich regelmäßige zurecht, und zum Schluß sind sie wieder unregelmäßig, also: ich kann - ich kanne - ich kann; er pfiff - er pfeifte - er pfiff usw. Manchmal bleibt es aber auch bei der regelmäßigen Form, und das ist dann Sprachwandel. Es gibt auch hyperkorrekte unregelmäßige Formen, aber eher selten. Das Streben der Rechtschreibreformer ging stellenweise dahin, (scheinbar) unregelmäßige Schreibweisen regelmäßig zu machen. Dabei wurden aber andere Regeln übersehen, und man muß nun abwarten, was dabei herauskommt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.10.2007 um 10.04 Uhr |
|
Wenn ich nun schon einmal beim Abschweifen bin, will ich es gleich ordentlich tun. In einem einflußreichen Aufsatz hat Mark Gold vor vierzig Jahren bewiesen, daß Sprachen nicht gelernt werden können. Unsere kleinen Kinder wissen das nicht und lernen ihre jeweiligen Muttersprachen ohne Bedenken. Das erinnert an die Hummeln, die bekanntlich nicht fliegen können, dies aber nicht wissen und munter losbrummen. Golds Beweis ist von Gödelscher Kompliziertheit (Gödel wird auch erwähnt) und dürfte nur von wenigen gelesen und noch wenigeren verstanden worden sein, was aber der Zitierfreudigkeit der Nativisten nicht im Wege steht, im Gegenteil. Wer ihn trotzdem lesen möchte, kann ihn unter verschiedenen Adressen herunterladen: Gold, E. Mark: Language Identification in the Limit. Information and Control, 10:447–474, 1967. Eine geistreiche Auseinandersetzung mit dem grundfalschen, von Gold zugrunde gelegten Sprachbegriff findet man zum Beispiel hier: http://www.ling.ed.ac.uk/~gpullum/bcscholz/Exuberance.pdf (Pullum und Scholz sind überhaupt lesenswert, es gibt mehrere Aufsätze im Internet) Ungefähr um dieselbe Zeit haben Chomsky und seine Anhänger die Unlernbarkeit und damit Angeborenheit der Sprache auch mit folgender Argumentation begründet: Schon aus zehn Wörtern kann man durch Permutation soundso viele Billionen Sätze bilden, und die alle auswendig zu lernen würde ein Lebensalter von astronomischem Ausmaß nicht ausreichen, folglich .... Besonders der Psychologe George A. Miller brillierte mit diesem Punkt - ausgerechnet um Skinner zu widerlegen! Ich nehme an, daß Skinner nicht einmal ein müdes Lächeln dafür übrig hatte. |
Kommentar von hannah schmalk, verfaßt am 12.10.2007 um 14.38 Uhr |
|
was Sie zum gähnen finden, halte ich für bedeutend interessanter als die abfälligen bemerkungen in den vorigen einträgen und kommentaren, die von "sogenannten philosophen", "reformpeitschern", "fanatikern", "faschistischem umgang" u.ä. schimpfen. es sollte hier doch eher um die sprache denn um die eigenschaften einiger ihrer sprecher gehen. die veränderungen im sprachgebrauch werfen ein problem für bewährte (nunmehr: alternative) wörterbücher auf. wie halten Sie, herr ickler, es in zukunft mit der orientierung an der sprachwirklichkeit? ein projekt wie der "ickler-duden" ist mit etablierung der reformen ja nicht mehr wie gehabt durchzuführen - es sei denn, man wollte die sich derzeit vollziehenden änderungen im tatsächlichen schriftdeutsch ignorieren. zuletzt wurde hier aufs köstlichste von all den malen berichtet, die man vielerorts serviert bekommt: wird sich dies schließlich nicht auch im verzeichnis eines wörterbuches niederschlagen müssen, das den sprachgebrauch erfassen und behutsam begleiten, nicht aber kontrafaktisch regieren möchte? |
Kommentar von David Konietzko, verfaßt am 12.10.2007 um 17.16 Uhr |
|
"die sich derzeit vollziehenden änderungen im tatsächlichen schriftdeutsch" sind keine Erscheinungen des natürlichen Sprachwandels, sondern von der Staatsmacht gegen die natürlichen Entwicklungstendenzen der Sprache erzwungen worden. Vor der Reform wurde die Schreibentwicklung durch die damalige Dudennorm zwar verlangsamt, aber nicht in eine andere Richtung gelenkt. Das Icklersche Rechtschreibwörterbuch, das ja gerade als Gegenentwurf zur staatlichen Sprachplanung von 1996 gedacht ist, kann nicht die Ergebnisse ebendieses Eingriffs anerkennen, ohne unglaubwürdig zu werden. Ein Deskriptivismus, der durch "Sprachbeobachtung" dem Präskriptivismus zum Sieg verhilft, führt sich selbst ad absurdum. Zur Zeit befindet sich unsere Sprache in einem Selbstheilungsprozeß, der allerdings – u. a. wegen der Rechtschreibprüfungen in Textverarbeitungsprogrammen – noch lange dauern kann. Mit der schlechteren s-Schreibung nach Heyse und manch anderem wird man wohl dauerhaft leben müssen, aber Kontraintuitives und Ungrammatisches wie zwei Mal dürfte allmählich verschwinden. In dieser Lage ist es Aufgabe des Lexikographen, den orthographischen Zustand vor dem staatlichen Attentat festzuhalten, um die Rückkehr zur Normalität zu beschleunigen; mit mangelnder "orientierung an der sprachwirklichkeit" hat das nichts zu tun. "kontrafaktisch regieren" diejenigen, die die "Reform" ausgedacht und durchgeführt haben, nicht die, die bei der Schadensbegrenzung helfen. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 12.10.2007 um 19.37 Uhr |
|
Der Ausdruck "unregelmäßige Verbformen" ist unberechtigt abwertend. Es gibt Verben, deren Präsens-Konjugation ("suppletiv") aus zwei Wortstämmen und einer eigenen Infinitivform gebildet wird ("sein") und Ablaut-Verben (mit eigenem Präteritum- und Perfekt-Stamm). Das ist gemeinindogermanisches Erbe, und mindestens in den nord- und westgermanischen Sprachen sehr ähnlich, also keineswegs eine deutsche Besonderheit. Willkürlich unregelmäßig erscheint vielmehr die hochdeutsche Pluralbildung mit Umlaut und unterschiedlichen Endungen, die in den übrigen germanischen Sprachen einschließlich des Niederdeutschen stark vereinheitlicht wurde (außerdem in den romanischen und slawischen Sprachen), sodaß das Deutsche in der Pluralbildung ein Unikat ist. |
Kommentar von Christoph Schatte, verfaßt am 12.10.2007 um 21.55 Uhr |
|
Der Name "unregelmäßige Konjugation der Verben" suggeriert, daß nur die schwach flektierenden "regelhaft" seien. Aber das ist irrfeührend bzw. irrig. Daß Verben Infinitiv-, Präsens-, Präterital- und Partizipialstamm haben (können), ist eher eine Regel(mäßigkeit) der indogermanischen Sprachen. Am ehesten unterliegen selten verwendete starke Verben der Deformation. Von "biologischen / genetischen "Ursachen" der Stabilität bzw. Instabilität kann also nicht die Rede sein, schon weil Sprachsysteme nicht viel gemein haben mit Erbmasse und so. Nichts gegen sog. Paradigmenwechsel; Paradigmenprostitution dagegen sollte allerorten unterbleiben. Althergebracht kann man also von starken und von schwachen (nicht von schweren und leichten!) Verben sprechen. So weiß jeder, worum es geht. Unregelmäßig indessen sind Verben wie bringen, weil in ihrer Flexion Elemente beider Paradigmata ("gemischt") erscheinen. Im Deutschen sind die intransitiven starken Verben älter als die ihnen zugesellten transitiven schwachen. Im Polnischen ist es umgekehrt, d.h. die Basis bilden transitive Verben, denen intransitive per Reflexivum zur Seite stehen. Die Pluralbildung der deutschen Maskulina und Neutra ist höchst unregelmäßig. Sie hat schon so manchen Morphologen dazu verführt, viele Lebensjahre zu opfern, um ein "System" der Pluralbildung für Maskulina und Neutra zaubern (Sträucher und Bäuche kümmert es nicht). Zum Glück sind wenigsten die femininen Plurale regelmäßig, – bis auf ein paar Ausnahmen, versteht sich. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.10.2007 um 05.14 Uhr |
|
Natürlich liegt es mir fern, mit dem herkömmlichen Ausdruck "unregelmäßige Verben" etwas Abwertendes zu verbinden, uns Sprachwissenschaftlern sind sie ja im Gegenteil besonders lieb und teuer, Jacob Grimm fand sie "stark". Mir kam der Ausdruck auch deshalb gelegen, weil ich die "regelmäßig" ablautenden mit anderen unregelmäßigen Paradigmen, vor allem den Präteritopräsentien und den suppletiven, zusammenfassen wollte. Die Regelmäßigkeit der ablautenden Verben ist durch analogischen Ausgleich noch weiter verdunkelt worden, aber die dritte Klasse (Nasal + Konsonant) ist immerhin noch so ausgeprägt, daß neue Zuordnungen (nicht nur in der Kindersprache) vorkommen. Von finden - fand - gefunden geht also, salopp gesprochen, ein gewisser Sog aus: winken - (wank) - gewunken. Was die Einwendung von Frau Schmalk betrifft: Jeder kann Wörterbücher machen, auch auf der Grundlage der gegenwärtigen verordneten Norm. Das war und ist allerdings nicht meine Sache, wie Herr Konietzko schon klargestellt hat. Zum Gähnen ist es, wenn längst bekannte Tatsachen immer wieder als Neuigkeiten dargestellt werden. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 13.10.2007 um 10.34 Uhr |
|
Im Englischen ist sehr gut zu beobachten, daß die am häufigsten gebrauchten Wörter, nämlich die germanischen, Verben-Ablaut und Umlaut-Plural bewahrt haben und sogar noch ausbauen: amerikanisch umgangssprachlich "get, got, gotten".
|
Kommentar von Horst Ludwig, verfaßt am 13.10.2007 um 18.01 Uhr |
|
Zu "get, got, gotten" (#10426): Es ist eigentlich umgekehrt. Hier liegt kein "Ausbau" vor, sondern das ursprüngliche "-en" ist in "gotten" noch nicht ausgefallen. Vereinfachung der verschiedenen Formen haben wir dagegen sehr häufig in der Angleichung der Imperfekt- und Perfektpartizipstämme (ein golfspielender Priester hier: "It should have went in"). Aber das ist zu erwarten; bei allen schwachen Verben sind ja diese beiden Formen gleich, und bei vielen starken ja auch, — und wir dürfen nicht vergessen, daß "drank" durch gelehrte Begierde wieder eingeführt wurde, nachdem es im Sprachgebrauch selbst schon weggefallen war, wie bei "fling, flung, flung" anerkanntermaßen auch. Neu eingebaut dagegen ist "dove" als Imperfekt zu "dive" bei allen Schwimmtrainern hier. Jedoch ist oder hat auch bei denen noch niemand vom Ein-Meter-Brett ge-"diven". Diese unhistorische Form "dove" steht also neben unserem (auch Theodor Storms) "frug".
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.07.2008 um 12.51 Uhr |
|
Michael Tomasello, ein nicht uninteressanter Wissenschaftler, behauptet in einem seiner neueren Werke (Constructing a language, 2003), Skinner habe den Spracherwerb durch "Assoziationen" erklärt, gar "simple associations". Er kann Skinners Buch nicht gelesen haben und wird es auch nie lesen. Denn durch Chomskys Rezension glaubt er schon zu wissen, was drinsteht, und das ist das größte, ja ein unüberwindbares Hindernis. In Wirklichkeit sind Tomasello, Pinker und viele andere auf dem Weg zum Behaviorismus und wissen es nicht. Nur die Skinnerianer im Umkreis des Journal of the Experimental Analysis of Behavior haben es längst bemerkt. |
Kommentar von Urs Bärlein, verfaßt am 08.07.2008 um 13.11 Uhr |
|
Castoriadis hat schon vor 30 Jahren den Behaviorismus (mit dem ich mich leider ebenfalls nicht gut auskenne) die unausgesprochene Philosophie der Sprachwissenschaft genannt.
|
Kommentar von Urs Bärlein, verfaßt am 08.07.2008 um 13.59 Uhr |
|
Präzisierungen: vor 33 Jahren; Castoriadis spricht von der Linguistik. Cornelius Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe, Paris (Le Seuil), 1975, p. 193; dt. Durchs Labyrinth, Ffm. (Suhrkamp) 1978, S. 169. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.01.2012 um 13.10 Uhr |
|
Eine Meldung geht um die ganze Welt: Amerikanische Forscher haben festgestellt, daß Säuglinge zuerst auf die Augen, in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres mehr auf den artikulierenden Mund und später wieder auf die Augen blicken. Das ist richtig, aber nicht neu. Die Lippen- und Mundbewegungen interessieren das Kind, weil es die artikulierte Sprache nur so beobachten und dann auch nachahmen kann. Sobald dies beherrscht wird, bieten die Augen mehr Information. Die Beobachtung der Mundbewegungen war schon immer das Gegenmodell zu Roman Jakobsons strukturalistischer Theorie des Spracherwerbs. Nach Jakobson würde das Kind zuerst maximale Oppositionen aufbauen: völliger Verschluß (p, m) vs. größte Öffnung (a) usw. Die Wahrnehmung und damit die Imitation wird hier also gar nicht einbezogen, die Entwicklung ist autonom. Gegenmodell: Das Kind kann die Lippen leichter beobachten als die Zunge oder gar das Zäpfchen usw. Daher die feste Reihenfolge: Labiale vor Dentalen vor Gutturalen. Das Kind muß sehen, wie das gemacht wird, was es hört. Vielleicht ist eine vermittelnde Position am besten. |
Kommentar von Bernhard Strowitzki, verfaßt am 18.01.2012 um 20.08 Uhr |
|
Noch so eine Gähnmeldung ist eine neue Variante der Glottochronolgie, über die kürzlich berichtet wurde. Diesmal will jemand den Ursprung der Sprachen durch den Vergleich des Phoneminventars bestimmt haben. Große Überraschung: Der Ursprung der Menschheit liegt in Afrika. So wie Afrikaner die größte genetische Vielfalt aufweisen (insgesamt, nicht der einzelne Mensch!), hätten die afrikanischen Sprachen, insbesondere die der Buschmänner (oder Khoi-San oder wie immer man pc sagt) die größte Zahl von Phonemen. Bei der Wanderung der Menschen sei dann immer mal wieder ein Phonem verlorengegangen, so daß Sprachen fern vom Ausbreitungszentrum besonders phonemarm seien. Es macht sich natürlich immer gut, vermeintlich präzise Zahlen über das Alter dieser oder jener Sprache zu verkünden, darin liegt der Reiz der Glottochronologie für das breite Publikum. Seriös ist das wohl kaum, man nehme nur das enorm phonemreiche Irisch und das recht phonemarme Italienisch oder Spanisch. Natürlich können Phoneme immer wieder neu entstehen, denken wir nur an die Phonemisierung des i-Umlautes im Deutschen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.08.2012 um 05.56 Uhr |
|
Nun geht wieder mal die Sensationsmeldung um die Welt, die indogermanischen Sprachen stammten aus Anatolien. Dieselbe These haben dieselben Forscher (Quentin Atkinson u. a., alle keine Linguisten) schon 2003 verbreitet (Quentin Atkinson und R. D. Gray: ‘Language-tree divergence times support the Anatolian theory of Indo-European origin’, Nature 426, 2003, S. 435-439), und die Methode war auch dieselbe, Lexikostatistik. Nun wird wohl auch ihre zweite These bald recycelt werden: Die Sprache überhaupt entstand in Afrika, aufgrund eines Vergleichs der Phoneme. Zeitungsberichte neigen dazu, solche Außenseiter zu Helden zu stilisieren, die es nun endlich einmal den etablierten Fachidioten zeigen und natürlich einen "Sturm der Entrüstung" usw. hervorrufen. Geschenkt! |
Kommentar von Wolfgang Wrase, verfaßt am 06.10.2012 um 04.08 Uhr |
|
(Ergänzung zum vorigen Beitrag von Professor Ickler) Gestern abend wurde bei "Wer wird Millionär?" die 16.000-Euro-Frage gestellt: Wessen Ursprung läßt sich neuesten Untersuchungen zufolge rund 9.000 Jahre zurück bis nach Anatolien verfolgen? Zur Auswahl standen die deutsche Gründlichkeit, der Deutsche Schäferhund, die deutsche Sprache und der Deutsche Alpenverein. Als richtige Antwort war die deutsche Sprache vorgesehen. Dieser Irrtum hatte leider keinen Skandal zur Folge, weil der Kandidat schon ausgestiegen war und die Antwort nur der Vollständigkeit halber noch genannt wurde. Interessant ist, daß die Sendung wie alle anderen Folgen zeitversetzt online abgerufen werden kann, aber beim zugehörigen Archiv zum privaten Nachspielen der letzten Sendungen fehlt diese Fragerunde. Möglicherweise haben Zuschauer protestiert, und die Redaktion hat darauf verzichtet, sich mit ihrem Archiv Ärger einzuhandeln. Richtig ist, daß die Wissenschaft das Urindogermanische zeitlich im 4. Jahrtausend vor Christus ansiedelt und mehrheitlich die südrussische Steppenlandschaft – Gebiete nördlich des Kaukasus und des Schwarzen Meers – als Urheimat ansieht. Die Anatolien-Hypothese von Renfrew gilt im wesentlichen als widerlegt. Normalerweise sind die Antworten der WWM-Redaktion hieb- und stichfest. Daß sie auf die aktuell wiederaufgewärmte Sensationsmeldung "Anatolien ist die Urheimat unserer Sprache" hereingefallen ist, zeigt, wie unkritisch die Presse solche Enten verbreitet. Die Redaktion fand bei ihrer Recherche dieselbe "wissenschaftliche" Meldung in vielen Zeitungen, also erschien sie ihr vertrauenswürdig. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.07.2013 um 07.28 Uhr |
|
Einige Forscher versuchen, aus der Anatomie unserer fossilen Vorfahren auf deren Fähigkeit oder Unfähigkeit zur Sprache zu schließen. Das ist nicht möglich, weil die Sprache keine Frage der Anatomie ist, oder allenfalls in dem Sinne, daß bestimmte Nervenbahnen gegeben sein müssen, damit die durch soziales Lernen beeinflußbare Steuerung der notwendigen Muskeln möglich wird. Die Nerven sind jedoch bei Fossilien nicht greifbar. Speech would not be impossible with an ape vocal tract, but it would be less expressive, with fewer vowels available (Lieberman, 2008; de Boer & Fitch, 2010) (Zitiert nach Sverker Johansson, der zur Frage der Datierung Lesenswertes geschrieben hat.) Es geht meist um die tiefe Stellung des Kehlkopfes und um Form und Lage des Zungenbeins. Kurioserweise rekonstruiert die (frühe) Laryngaltheorie fürs Protoindogermanische gerade ein solches vokalarmes System ... |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 16.07.2014 um 15.18 Uhr |
|
Ich hoffe, diese Bemerkung ist nicht zum Gähnen, ich setze sie hier hinein, weil ich nur hier etwas über Mundbewegungen gefunden habe. Auch bei der gerade beendeten Fußball-WM ging es in einem Fernsehbeitrag darum, daß Trainer Löw sich schon mal beim Sprechen den Mund bedeckt, wenn er sicher sein will, daß ihm per Teleobjektiv niemand etwas von den Lippen abliest. Ich finde ja diese Fähigkeit, Gesprochenes von den Lippen abzulesen, faszinierend, eigentlich fast unbegreiflich. Kann man denn Laute, die so gut wie nur mit der Zunge gebildet werden (r, l, n, s, z, g, k, d, t, h, j, ch, x), also die meisten Konsonanten, überhaupt "sehen"? Laute mit mehr Lippenbewegung (m, b, p, f, v, w, sch) sind schon eher zu erkennen, aber z. B. der Unterschied zwischen m und b ist doch bei normalem Sprechtempo auch sehr gering. Lange Vokale sind wohl nach einiger Übung ganz gut zu erkennen, aber bei kurzen Vokalen gibt es auch kaum Unterschiede in der Mund- bzw. Lippenform. Deshalb wundert es mich, wie unglaublich viel Redundanz doch in der gesprochenen Sprache liegen muß, daß es manche Leute anhand der wenigen wirklich sichtbaren Merkmale dennoch fertigbringen, Gesprochenes zu sehen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.08.2014 um 08.22 Uhr |
|
Sprachen, die – zuerst in vulgärer Aussprache – das "h" fallenlassen, neigen bekanntlich dazu, es hyperkorrekt an Stellen wiedereinzusetzen, an die es nicht gehört. Ein bekanntes frühes Beispiel ist "hinsidiae" ("hinsidias parare") für "insidiae", worüber sich Catull lustig macht. Ich habe mich – dies sei ins Unreine gesprochen – schon mal gefragt, ob manches hethitische "h", das die Laryngaltheorie zu bestätigen scheint oder auch gerade nicht, vielleicht so zu erklären ist. Das fiel mir wieder ein, als ich in Protokollen der Sprachentwicklung meiner Töchter nachlas. Dort bin ich noch auf etwas anderes gestoßen: Meine älteste Tochter, in Indien mit einem viersprachigen Gemisch, aber überwiegend Englisch aufwachsend, setzte vor manche vokalisch anlautenden Wörter ein spontanes "h": "hinside, hauntie". Vielleicht ein Versuch, den Knacklaut wiederzugeben, den sie ja, wie berichtet, auch in der Schrift nicht übergehen zu sollen glaubte. Sie war damals knapp drei. Das hethitische h könnte in manchen Fällen auch ein Interferenzphänomen sein. Sänger werden bekanntlich angehalten, den ungesunden Knacklaut durch ein h zu ersetzen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.09.2014 um 04.53 Uhr |
|
Ich hatte Sverker Johansson erwähnt, deshalb schalte ich hier eine Bemerkung zu ihm ein. Zufällig bin ich auf die Meldung gestoßen, daß dieser Physiker und Linguist rund zehn Prozent aller Wikipedia-Einträge erzeugt hat, rund 10 000 täglich: „Sverker Johansson entwickelte den Lsjbot, einen Bot, der seit Januar 2012 weitgehend automatisch neue kurze Artikel (Stubs) bei der Wikipedia abarbeitet. Es entstanden in der schwedischen, Cebuano- und Wáray-Wáray-Wikipedia beinahe 3 Millionen Artikel.“ (Wikipedia, Druckfehler korrigiert) Seine Arbeiten zum Ursprung der Sprache sind keineswegs unseriös, wie man nun vielleicht glauben könnte, sondern im Gegenteil anregend, auch wenn ich nicht alles richtig finde. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.02.2015 um 08.31 Uhr |
|
Nun steht in allen Zeitungen, daß sehr junge Väter mehr Chromosomenschäden an ihre Kinder übertragen, was zu höheren Quoten an Schizophrenie und Spina bifida führen könnte. Die Beweislage scheint mir sehr dünn zu sein, soweit man es der Presse entnehmen kann. Das ist natürlich kein Grund, an dieser Stelle darauf einzugehen. Hauptautor Peter Forster ist aber der Genetiker, der aus seiner Wissenschaft auch weitreichende Folgerungen zur Herkunft und Ausbreitung der Sprachen und Sprachfamilien gezogen hat. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.04.2017 um 08.31 Uhr |
|
Die regelmäßige Komparation von gern ist seit dem 19. Jahrhundert schriftsprachlich ausgestorben, das suppletive, seit dem Mittelalter gebräuchliche lieber/am liebsten allein üblich. Nur in Dialekten noch anders. Schwer zu erklären ist auch: gern – sehr gern - *höchst gern ungern – sehr ungern – höchst ungern ungerner, am ungernsten - *gerner, *am gernsten |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.08.2017 um 07.19 Uhr |
|
Wie gesagt, Hummeln können aus physikalischen Gründen nicht fliegen. Windräder sind Unsinn, wie z. B. Günter Keil (AfD, Achse des Guten) seit Jahren messerscharf beweist. Allerdings kann man "den größten und verhängnisvollsten Schaden, den die Regierung dem Land zufügt", nicht allein "dieser Frau", die zu allem Überfluß auch noch Physikerin ist, in die Schuhe schieben, denn in den USA und China und überhaupt weltweit werden ja noch viel mehr Windräder errichtet. Aber egal, wir wollen unsere schönen Atomkraftwerke wiederhaben! |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.09.2017 um 08.33 Uhr |
|
Kann ein Sprachratgeber sich mit der Auskunft "gilt als falsch" zufrieden geben? Solche Bücher (Duden, Wahrig) sprechen nicht selbst normativ, sondern zitieren die Norm nur – aber woher? Deskriptiv wäre es, wenn sie die Textsorten, Register, Fundstellen angäben, an denen ein Ausdruck vorkommt oder eben nicht vorkommt, also vermutlich gemieden wird. Andernfalls schwebt immer eine nie ausgesprochene Schulweisheit im Hintergrund. Die Altphilologen haben das Vorkommen und Nichtvorkommen in ihrem Textcorpus sehr sorgfältig dokumentiert. Daraus kann man dann auch normative Schlüsse ziehen, nach dem Muster: "kommt vor, aber nicht klassisch, nicht bei Cicero" usw. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.05.2021 um 06.10 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=907#10416 G. A. Miller (1962) has set up the straw man that there are too many combinations of words for a child to learn to emit all the sentences he will eventually say, without benefit of generative rules of grammar. But behaviorists (Skinner, 1957) never did discuss single responses only. Language is acquired in the form of response classes and their interrelationships. (Kurt Salzinger) Die Dummheit, zu der sich der sonst so kluge George A. Miller unter Chomskys Einfluß hat hinreißen lassen, wird selbst unter Kognitivisten und Nativisten nicht ernst genommen und nur von sehr untergeordneten Autoren referiert. Kein Behaviorist hat je angenommen, daß ein Kind die Sätze auswendig lernt und nachahmt, aus denen die Sprache (nach generativistischer Auffassung, nicht nach behavioristischer) "besteht". |
