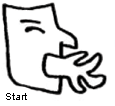


| Diskussionsforum | Archiv | Bücher & Aufsätze | Verschiedenes | Impressum |
Theodor Icklers Sprachtagebuch
29.03.2013
Homunkulus
Zur Kritik des Kognitivismus
Aktiv oder passiv – eine sinnlose Unterscheidung
Besonders in der kognitivistischen Kritik am Behaviorismus hat sich ein Gemeinplatz ausgebreitet, der vom „rattomorphistischen“ Welt- und Menschenbild der Behavioristen das angeblich humanere der Kognitivisten abzuheben versucht. Das meistbenutzte Begriffspaar lautet „aktiv“ vs. „passiv“:
„Fest steht (...), daß Sprachwahrnehmung kein passiver oder bloß rezeptiver Aufnahme- und Decodierungsvorgang ist, sondern in allen Phasen (auch den peripheren, vermeintlich rein sensorischen) aktive Konstruktions- und Vergleichsprozesse involviert.“ (Clemens Knobloch in Glück 1993:589)
„Dieses Tätigkeitsmodell [der sowjetischen Psychologie] unterscheidet sich grundlegend vom bloßen passiven Reagieren auf äußere Stimuli (wie etwa im Behaviorismus)“ ... (Wolfgang Heinemann/Dieter Viehweger: Textlinguistik. Tübingen 1991:61)
Gerhard Helbig wertet kindersprachliche Übergeneralisierungen oder Analogiebildungen als Zeichen dafür, daß Spracherlernung keine „bloße Nachahmung“, „keine passive Nachahmung“ sein könne, sondern „aktive, abstrahierende Tätigkeit“, „aktives, schöpferisches Verhalten“, „aktive psychische Prozesse“ (Sprachwissenschaft - Konfrontation - Fremdsprachenunterricht. Leipzig 1981).
„Die Behavioristen nehmen an, daß Lernen passiv unter der Kontrolle externer Stimuli erfolgt. (...) Es ist klar, daß über externe Stimuli nur wenig, wenn überhaupt bedeutungsvolles Lernen bewirkt wird.“ (Ashgar Iran-Nejad in Siegfried J. Schmidt, Hg.: Gedächtnis. Frankfurt 1992:238f.) Dagegen stellt der Verfasser „die zentrale interne Steuerungsinstanz des Informationsverarbeitungssystems“ (240). „Aktive Steuerung ist Steuerung auf der Ebene des Ganzen, sie ist der Typ von Steuerung, der von einem Ganzen auf dessen einzelne Teile ausgeübt wird.“ (241)
„Daß Textverstehen kein passives Aufnehmen von Information, sondern ein höchst aktiver Vorgang 'im Kopf' ist, ist im letzten Jahrzehnt (...) durch die Gedächtnispsychologie und Psycholinguistik verdeutlicht worden.“ (Gerhard Neuner in Ders., Hg.: Kulturkontraste im DaF-Unterricht. München 1988:11)
Kognitivisten legen Wert auf die Aktivität als Merkmal der von ihnen untersuchten Vorgänge:
„Anpassung ist, wie alle Gegenstände der Psychologie, ein aktiver Prozeß.“ (Mario von Cranach u.a.: Zielgerichtetes Handeln. Bern 1980:79)
Auch nach Ulric Neisser ist Sehen ein „aktiver Prozeß“ (Ulric Neisser: Kognitive Psychologie. Stuttgart 1974)
„Hören ist kein passiver, sondern ein sehr aktiver Vorgang. (...) Der Text schickt Signale aus, die den Hörer auffordern, seinem Gedächtnis Inhalte zu entnehmen. (...) Verstehensstrategien sind problemorientierte, erlernbare (also auch lehrbare), bewußt einsetzbare, durch häufigen Gebrauch aber auch automatisierbare Techniken der effizienten Texterschließung.“ (Gert Solmecke: „Ohne Hören kein Sprechen“. Fremdsprache Deutsch 1992:4-11)
„Verstehen ist kein passives Aufnehmen von Information, sondern ein aktiver Prozeß, in dem die Lernenden eigenes Wissen, eigene Lese- und Verstehensstrategien einsetzen.“ (Hans Jürgen Krumm in Fremdsprache Deutsch 1990:20)
„Bereits damals (zu Beginn der modernen Spracherwerbsforschung Ende des 19. Jahrhunderts) gab es heftige Kontroversen über die Frage, ob Kinder ihre Sprache passiv durch Imitation oder kreativ und aktiv durch Verstehen der Umwelt lernen. (...) Behavioristisches Lernen beschreibt den Lernvorgang als Imitation und passiv erduldete Dressur. (...) Die Steuerung erfolgt auschließlich exogen. Am Anfang ist der Lerner eine Art tabula rasa. (...) Vor allem (...) findet die Art von kreativer Verarbeitung, die sehr charakteristisch für Sprachenlernen ist, im behavioristischen Ansatz keinen Platz. Hier bleibt der Lerner passiv. (...) Die Leistung des menschlichen Gehirns besteht nicht nur in einem passiven Registrieren von Sinneseindrücken, sondern auch und vor allem in ihrer Aufarbeitung und vielfältigen Koordinierung. (...) Es ist wichtig zu erkennen, daß das Gedächtnis in starkem Maße selbst aktiv werden und Informationen eigenständig verarbeiten kann.“ (Henning Wode: Psycholinguistik. München 1993)
„Lernen erfolgt nicht passiv, sondern ist ein aktiver Vorgang, in dessen Verlauf sich Veränderungen im Gehirn des Lernenden abspielen.“ (Manfred Spitzer: Lernen. Heidelberg 2002:4)
„Nun weiß man aber sowohl aus Untersuchungen des Erstspracherwerbs als auch aus solchen des Zweit- bzw. Fremdspracherwerbs, dass der Lerner den sprachlichen Input nicht nur passiv aufnimmt, sondern dass er ihn aktiv verarbeitet und in seine Wissensstruktur integriert. Sprachenlernen kann damit als ein kontinuierlicher kreativer Prozess des Bildens, Testens und Revidierens von Hypothesen über die Regularitäten der zu lernenden Sprache gelten.“ (Maria Thurmair: Die Rolle der Linguistik im Studium Deutsch als Fremdsprache. gfl 2/2001)
Hans Lenk verbreitet den ganzen Unsinn vom „aktiven“ Konstruieren anstelle des „passiven“ Ablesens, wie es der Behaviorismus angeblich angenommen habe. (Von Deutungen zu Wertungen. Frankfurt 1984:93) „Helmholtz' unbewußte 'Deduktion' ist wohl heute zu ersetzen durch Hypothesen- oder Interpretationsbildung und muß auf aktive, unterbewußte Verarbeitung bezogen werden.“ (94) „Wahrnehmung ist also konstruktiv im Sinne einer zentralnervösen Tätigkeit, sie ist eine Gehirntätigkeit, eine aktive Konstruktionstätigkeit.“ (95) „Es ist nicht damit getan, daß bei der Wahrnehmung etwas Externes einfach reproduziert, abgebildet wird. Die Kamera- oder Abbildtheorie der Wahrnehmung ist ebenso wie die bloße Reiztheorie falsch. Es handelt sich beim Wahrnehmen stets um ein aktives Selektieren, Strukturieren, Konstruieren oder wenigstens um ein Rekonstruieren.“ (103)
Norbert Groeben u. a. heben immer wieder hervor, daß ihr Forschungsprogramm Subjektive Theorien den Menschen als „aktiv“ oder „aktiv konstruierend“ betrachte, im Gegensatz zum Behaviorismus, der den Menschen mechanistisch als außengesteuertes Objekt angesehen habe. (Norbert Groeben u. a.: Forschungsprogramm Subjektive Theorien. Tübingen 1988:S. 6; 13 u.ö.
Hallpike stellt eine auf Piaget aufbauende Ethnologie dar. Die empiristische Lerntheorie betrachte Wissen nur als „passive Reproduktion von Sinneseindrücken“ (Christopher R. Hallpike Die Grundlagen primitiven Denkens. München 1990:16). Dagegen stellt er den Piagetschen Konstruktivismus:
„Menschen handelten nicht aufgrund eigener Ideen oder Intentionen so, wie sie handelten, oder weil ihre kognitive Ausstattung bestimmte autonome Strukturierungstendenzen verkörperte, sie spiegelten vielmehr passiv verschiedene Kräfte und Faktoren ihrer Umwelt wider.“ (Howard Gardner: Dem Denken auf der Spur. Der Weg der Kognitionswissenschaft. Stuttgart 1989:23 über den Behaviorismus) „Bransfords Ergebnisse zeigen kein passives, mechanisches Erinnern, sondern weisen darauf hin, daß Versuchspersonen Information aktiv und konstruktiv verarbeiten und Bedeutungen erschließen, statt sich an bloße Wortreihen zu erinnern.“ (ebd.139)
„Der Prozeß der Sprachaneignung ist jedoch kein passives Aufnehmen vorgefundener Sprachmittel und -strukturen, sondern ein durchaus eigenständiger Nachvollzug der Sprache durch das Kind.“ (Gabriele Pommerin in „Zielsprache Deutsch“ 1982:3)
„Der Hörer ist (...) nicht nur ein passiver Empfänger, der entweder richtig oder falsch versteht. Vielmehr ist Verstehen ein aktiver kognitiver Prozess eines Individuums, das eigene Ziele verfolgt, die sich im Normalfall von denen des Sprechers unterscheiden.“ (Klaus-Peter Wegera/Sandra Waldenberger: Deutsch diachron. Eine Einführung in den Sprachwandel des Deutschen. Berlin 2013:242)
„Until recently, it was assumed that an individual played a passive role in conditioning, with associations formed and strengthened automatically by the reinforced pairing of stimulus events and behavior manipulated predictably by environmental events. What was learned was assumed to be fixed associations and specific responses.“ (Philip G. Zimbardo: Psychology and life. Glenview 1988:294)
Etwas anders drückt Felix denselben Gedanken aus:
„Die Nativisten sehen den Menschen eher als einen agierenden und weniger als einen reagierenden Organismus an.“ (Sascha W. Felix: Psycholinguistische Aspekte des Zweitsprachenerwerbs. Tübingen 1982:188)
Wie sich bereits andeutete, mischen viele Autoren ihrer Darstellung einen teils polemischen, teils werbenden Ton bei und rücken die angeblich inhumanen Behavioristen auch moralisch ins Zwielicht. Helbig sagt mit dem Blick auf die „Überwindung“ des Behaviorismus durch die generativistische Theorie:
„Man erkannte wieder (...), daß die Lernenden einen Kopf haben, die Lehrer keine Tiertrainer, die Schüler keine Zirkuspferde sind.“ (Sprachwissenschaft - Konfrontation - Fremdsprachenunterricht. Leipzig 1981:35)
Monika Schwarz wählt in ihrem recht naiven Überblick über den Werdegang der Psychologie (vom Behaviorismus über einen durch Chomsky eingeleiteten „Paradigmenwechsel“ zur Kognitiven Psychologie) ihre Worte so, daß der Mentalismus gleichsam vornehmer dasteht als der platte Behaviorismus: Der Mentalismus nimmt „zielgerichtete Aktivitäten“ an statt „kausaler Mechanismen“, die auf „simple Reiz-Reaktions-Kontingenzen“ hinauslaufen usw. (Kognitive Semantiktheorie und neuropsychologische Realität. Tübingen 1992:12f.)
Das Beharren auf dem „Kreativen“ am Spracherwerb nimmt manchmal geradezu religiös-inbrünstige Züge an:
„The cognitive process of learning appreciates the real human characteristics of man: he is not locked within his habits; he possesses a creative force which expresses itself not only in his philosophical thinking and in his art, but also in his language: every sentence he speaks originates from a receptacle which has openness. It is a creative linguistic act, which remains within the system of rules (rulegoverned creativity).“ (L. K. Engels in Christoph Gutknecht, Hg.: Grundbegriffe und Hauptströmungen der Linguistik. Hamburg 1977:286)
John Searle sieht Chomskys größten Beitrag auf lange Sicht darin, „daß er einen wichtigen Schritt zu einer Rehabilitierung der traditionellen Auffassung von der Würde und der Einzigartigkeit des Menschen getan hat.“ („Chomskys Revolution in der Linguistik“, in: Günter Grewendorf/Georg Meggle, Hg.: Linguistik und Philosophie. Frankfurt 1974:404-438, S. 438)
Dazu paßt, daß der Behaviorismus durchgehend falsch als „Reiz-Reaktions“-Theorie dargestellt wird. Leo Montada zum Beispiel behauptet, der Empirismus – Skinner wird ausdrücklich erwähnt – halte den Organismus für passiv. „Das Menschenbild des Empirismus ist ein mechanistisches, das Piagets ein organismisches. Modell des ersteren ist die Maschine, mechanischen Funktionsgesetzen gehorchend, in Ruhe bis ein äußerer Impuls den Anstoß zur Bewegung gibt.“ Laut Behaviorismus bilden sich passive Widerspiegelungen und Assoziationen usw. („Piaget und die empiristische Lernpsychologie“. In: Piaget und die Folgen. München 1978: 290ff.) Das entspricht einem Irrtum, der auch sonst weit verbreitet ist. Mit der Ausspielung des „Organismischen“ gegen das „Mechanistische“ kann man vor allem in Deutschland leicht einen rhetorischen Vorsprung gewinnen.
Die entscheidende Kritik an der kognitivistischen Darstellung geht nicht von der Tatsachenfrage aus, ob ein Prozeß oder ein Organismus „aktiv“ oder „passiv“ sei, sondern weist sie aus begrifflichen Gründen zurück. In diesem Sinne hat auch Theo Herrmann schon gefragt, wodurch sich ein aktiver Prozeß von einem passiven unterscheide. („Über begriffliche Schwächen kognitivistischer Kognitionstheorien: Begriffsinflation und Akteur-System-Kontamination“. Sprache und Kognition 1:3-14; S. 5) (Herrmann selbst hat sich allerdings in späteren Arbeiten nicht an seine eigene Kritik gehalten.) Ein Sieb hält „aktiv“ die größeren Körner zurück und läßt „passiv“ die kleineren passieren – das ist offenbar keine sinnvolle Unterscheidung. Der Stoffwechsel, ein wesentlicher Teil des Lebens, kann weder aktiv noch passiv genannt werden, er findet einfach statt, ebenso die Informationsverarbeitung im Nervensystem. Es ist verfehlt, Handlungsbegriffe auf subpersonale Vorgänge anzuwenden. Man gerät dadurch unweigerlich in eine überholte und nutzlose Homunkulus-Psychologie.
| Kommentare zu »Homunkulus« |
| Kommentar schreiben | neueste Kommentare zuoberst anzeigen | nach oben |
Kommentar von R. M., verfaßt am 29.03.2013 um 11.57 Uhr |
|
Die gleiche plumpe Unterscheidung findet sich in jeder Handbuchdarstellung der neueren britischen Philosophie seit Locke. Danach war James Mill ein Passivist, sein Sohn John Stuart Mill hingegen ein Aktivist, usw. So wogt es immer hin und her.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.04.2013 um 13.16 Uhr |
|
Die Wörter – das sind die Wörter, wie sie im Wörterbuch stehen, im Lexikon und zwar nicht nur in dem, das ein Lexikograph, ein Wörterbuchschreiber, gemacht hat, sondern auch in dem inneren Lexikon, das wir, wie unsere Sprache überhaupt, im Gehirn (wo sonst?) mit uns herumtragen. Wie immer dies innere Lexikon angelegt ist, wie immer es ‚arbeitet’, wie immer aus ihm beim Sprechen und Verstehen die Wörter ‚abgerufen’ werden – es muss ein solches Lexikon geben, auch wenn es, soviel ist jedenfalls sicher, nicht alphabetisch angeordnet ist. Die mehr oder weniger sorgfältig gearbeiteten Lexika der Lexikographen, die wir deutsch also zu Recht „Wörterbücher“ und nicht „Wortebücher“ nennen, suchen, dieses innere Wörterbuch abzubilden. (Gauger zu Worte/Wörter: www.deutscheakademie.de/sprachkritik/?p=196#more-196) — So denken viele, fast alle. Nur die Behavioristen nicht. Daß man bei bestimmten Gelegenheiten Wörter aussprechen kann, bedeutet doch nicht, daß diese Wörter in unserem Kopf gespeichert sind. Die Speichertheoretiker haben nicht die leisteste Ahnung, wie das Nachschlagen und Ablesen vor sich gehen soll. (Man spricht auch vom Scanning-Problem.) Ganz zu schweigen von der Speicherung selbst. Die These bleibt also völlig leer und wäre gar nicht ernst genommen worden, wenn nicht das scheinbar Zwingende dieses Trugschlusses wäre. Es gibt Pianisten, die zwanzig verschiedene Klavierabende geben könnten, ohne je in die Noten zu gucken. Was haben sie "gespeichert"? Nach Skinner verändert sich der Organismus (selbstverständlich) durch Lernen, aber er "speichert" nichts. (Und "repräsentiert" auch nichts, wenn dieses Wort noch einen unterscheidenden Sinn haben soll.) |
Kommentar von Wolfgang Wrase, verfaßt am 10.04.2013 um 14.41 Uhr |
|
Wie, in meinem Kopf ist nichts gespeichert?
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.04.2013 um 07.08 Uhr |
|
Nein, die Speicher-Begrifflichkeit ist irreführend. Lernen ist Anpassung, nicht Speicherung. Eine Mausefalle oder ein Fliehkraftregler sind Maschinen, die in bestimmter Weise auf die Umgebung "reagieren". Man kann aus ihnen Informationen über Mäuse bzw. Dampfmaschinen (Mühlen, Uhren, Plattenspieler usw.) ablesen. Man muß nur schon wissen, daß es Mausefallen bzw. Fliehkraftregler sind, denn erst zusammen mit der Peripherie sind es überhaupt solche Maschinen. Der Computer speichert ja auch nicht Texte wie diesen hier, sondern steuert eine Peripherie, in der es überhaupt erst zu Texten kommt, aber auch zu etwas anderem kommen könnte. Ebenso bei biologischen, also durch Phylogenese und Lerngeschichte "programmierten" Maschinen. Das einfache Nervensystem des schon besprochenen Schützenfischs steuert das Jagdverhalten des Fisches, aber die Informationen über die Beute, das Wasser, den Brechungswinkel, den Fischkörper usw. sind nicht in ihm "gespeichert". Die Suche nach dem Speicher kann keinen Erfolg haben, kein Biologe versucht sich daran. Nur Philosophen und Linguisten wollen es nicht begreifen. Wenn das mentale Lexikon (im Gehirn, wie Gauger treuherzig hinzufügt) nicht alphabetisch geordnet ist, so könnte es doch im Prinzip alphabetisch geordnet sein ... Und nun wollen wir uns mal ein Gehirn ansehen. (Kalbshirn tut es auch.) |
Kommentar von Andreas Blombach, verfaßt am 15.04.2013 um 09.55 Uhr |
|
Ein recht interessanter Artikel zum Thema, ob es ein "mentales Lexikon" gebe oder nicht, war m.E. dieser hier: crl.ucsd.edu/~elman/Papers/Mental%20Lexicon2011.pdf. Konnektionisten wie Elman scheinen es zwar noch für notwendig zu halten, sich von den Behavioristen zu distanzieren (in "Rethinking Innateness" z.B.), aber sie sind ihnen z.T. doch näher, als sie glauben. |
Kommentar von Wolfgang Wrase, verfaßt am 15.04.2013 um 13.54 Uhr |
|
Vielen Dank. Teilweise leuchtet das ein. Eine neue Sichtweise. Aber der Vergleich mit einem Computer? Dieser hat einen Arbeitsspeicher (Kurzzeitgedächtnis) und greift auf eine Festplatte zu (Langzeitgedächtnis). Daß ein Computer eine Peripherie braucht, um die Speicher zu füllen und nutzbar zu machen, ändert nichts daran, daß es Speicher sind.
|
Kommentar von Germanist, verfaßt am 15.04.2013 um 14.22 Uhr |
|
Irgendwo müssen meine Frendsprachen-Vokabeln abgespeichert sein. Je leerer der Speicher noch ist, desto leichter lassen sich Informationen abspeichern, und je voller er schon ist, desto mühsamer. Das Problem ist der Zugriff. Bei mir beträgt die Zugriffszeit auf weiter zurückliegende Informationen durchschnittlich 10 Minuten. Manches findet man nur durch Zufall wieder. Die Datenverarbeiter sprechen von "Assoziativspeicher", denn reines Warten hilft oft nicht, wohl aber Stichworte (oder Stichwörter?).
|
Kommentar von Wolfgang Wrase, verfaßt am 16.04.2013 um 03.01 Uhr |
|
Die Formulierungen von Professor Ickler klingen teils so, als werde nichts gespeichert ("nach Skinner"), teils heißt es, die Begriffe "Speicher" und "speichern" seien irreführend. Ohne mich in das Thema eingearbeitet zu haben: Es kann ja gut sein, daß es im Gehirn einen typischen, separaten Speicher nicht gibt, vielleicht nicht einmal irgendeine materielle Grundlage für eine separate Ablage von Informationen (etwa Eiweißmoleküle oder Bestandteile von Nervenzellen, die verschiedene Konfigurationen annehmen und je nachdem andere "Informationen" im Kontakt bereithalten können). Dennoch leistet das Gehirn unter anderem dasselbe wie ein Computerspeicher (jedenfalls etwas sehr ähnliches). Wieso sollte man dann nicht von einem Speicher reden? Ich schätze, daß die "Speicherung" auf ungewöhnliche, nicht sezierbare Weise zustande gebracht wird. Eine Speicherung ohne Speicher, ein Speicher (funktional) ohne Speicher (materiell).
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.04.2013 um 05.28 Uhr |
|
Um Worte soll man nicht streiten. Man müßte weiter ausholen, um die Untunlichkeit der Rede von mentalen Lexikon usw. darzutun. Im Augenblick begnüge ich mich mit der Behauptung, daß nichts gewonnen ist, wenn man sagt, der Pianist habe Beethovens Sonaten "gespeichert". (Ich habe sie übrigens auch gespeichert, erstens als Noten im Regal, zweitens als CDs und LPs, drittens lückenhaft im Kopf vom Anhören, nur spielen kann ich sie leider trotzdem nicht. Das gilt auch vom Fremdsprachenlernen: Speichern Sie nur! Aber wie kommen Sie von dort zum Sprechen?)
|
Kommentar von Germanist, verfaßt am 16.04.2013 um 13.10 Uhr |
|
Natürlich muß man auch grammatische Regeln abspeichern, z.B. welche Präpostion in welcher slawischen Sprache welchen Fall benötigt. Ohne Grammatikregeln kann man in diesen Sprachen keine Sätze bilden. Aber das wird durch Übung zu einem unbewußten Automatismus.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.04.2013 um 14.33 Uhr |
|
Man muß es eben lernen und üben, wie Bälle fangen usw. Der Organismus verändert sich durch die Anpassung an die Umwelt. Mit der Wahl des Begriffs "Speicherung" tut man so, als wüßte man, wie es geschieht. Schlimm, wenn man dann, von der eigenen Metapher verführt, nach dem Speicher sucht.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.04.2013 um 06.46 Uhr |
|
Die Generativisten (Chomsky-Anhänger) mit ihrer Regel-Besessenheit haben keine Sprachdidaktik entwickeln können, weil sie nie erklären konnten, wie sich das Regelanwenden "üben" läßt. Ihre Polemik gegen die behavioristische Auffassung von "habits" hat ihnen die Möglichkeit verbaut, Sprechen als Geschicklichkeitsleistung zu verstehen. Chomksy mußte daher schon früh behaupten, Sprechen sei etwas vollkommen anderes als Radfahren. Sprechen sei Regelanwenden, eine Fähigkeit, die etwa nach Piaget erst im pubertären Alter zu erwarten sei. Daher müsse Sprache angeboren sein usw. Sehr naiv.
|
Kommentar von Chr. Schaefer, verfaßt am 05.05.2013 um 07.33 Uhr |
|
Die Generativisten (Chomsky-Anhänger) mit ihrer Regel-Besessenheit haben keine Sprachdidaktik entwickeln können, weil sie nie erklären konnten, wie sich das Regelanwenden "üben" läßt. Die Rechtschreibreformer waren (und sind) natürlich auch Generativisten (ich glaube es war Herr Jochems, der die Neuregelung einmal als "generative Orthographie" bezeichnet hat). Dies beginnt schon bei der Annahme von "Laut-Buchstaben-Beziehungen". Bereits Hermann Paul hat mehrfach darauf hingewiesen (und an Beispielen belegt), daß dies ein Irrtum ist. In dem auf diesen Seiten bereits zitierten Buch von Augst/Dehn zum Rechtschreibunterricht wird jedoch diese falsche Annahme zugrundegelegt. Christa Röber und Helmut Spiekermann haben in einem Aufsatz (Zeitschrift für Pädagogik 46/2000) bemerkt, daß diese und ähnliche Ansätze ("Anlauttabellen", "Pilotsprache") schon im Ansatz verfehlt sind und Kinder erst dann selbständig richtig lesen und schreiben können, "wenn sie sich von dem in den Lehrgängen Gelernten in elementaren Bereichen gelöst haben", wenn also das Gelernte ("die Regeln") bewußt oder intuitiv als falsch erkannt wurde. Sie heben auch hervor, daß dies nur wenigen Schülern gelingt, also für die meisten schädlich ist. Am Rande sei bemerkt, daß die beiden es sich nicht verkneifen konnten, eine Perle der Augstschen Didaktik zu zitieren: "Schreibe, wie du sprichst, wie du explizit schreibst", ein Tip(p), für den jeder Grundschüler Herrn Augst gewiß die Füße küssen wird. Zusätzlich zu dieser Regelebene (d.h. Teil A der AR) haben die Reformer aber noch zwei weitere Ebenen eingezogen, nämlich zunächst die in den Teilen B bis F aufgeführten Regeln, die aber wegen ihrer Fixierung auf "formale" Kriterien außerdem die Kenntnis (teilweise auch die bewußte Ignorierung) fortgeschrittener "Grammatikregeln" erfordern. Eine vierte Ebene ist schließlich das Wörterverzeichnis, aus dem so manches hervorgeht, was man aus dem Regelwald nicht ableiten kann. Anders ausgedrückt: Man hat durch die als Fortschritt gepriesene Verregelung (die sich, wie Herr Ickler richtig bemerkt hat, nicht einüben läßt) das Lernen (Anpassung, Gewöhnung, wie man es auch immer beschreiben mag) erschwert. Gewußt hat all dies freilich auch schon der erfahrene Lehrer Konrad Duden, der im Vorwort zur ersten Auflage seines Wörterbuches bemerkte, "für alle diejenigen, die ohne den langsamern und schwierigern Weg der Anwendung allgemeiner Regeln auf einzelne Fälle zu betreten, mitten in der Arbeit des Schreibens, Korrigierens oder Setzens schnell und zuverlässig über ein bestimmtes Wort, dessen Schreibung ihnen im Augenblick unsicher ist, Aufschluß haben wollen, (sei) ein alle Wörter enthaltendes Nachschlagebuch geradezu ein unabweisbares Bedürfnis." (Hervorhebung von mir) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.10.2013 um 04.32 Uhr |
|
Lesen ist ein aktiver innerer Prozeß des Lesers. (Theodor Lewandowski: Deutsch als Zweit- und Zielsprache. Trier 1991:153) Lesen ist eine Tätigkeit, das bedarf keiner ausdrücklichen Feststellung. Das "Innere" ist eine Zutat aus dem Vorrat der Folk psychology, naiv und wissenschaftlich wertlos. Grammatisch anstößig ist auch schon die Rede vom Prozeß des Lesers. Nehmen wir großzügig an, daß es ein Vorgang im Leser sein soll, dann erhebt sich wieder die Frage, was aktive und passive Vorgänge unterscheidet. Kurzum, das Ganze ist sinnlos, entgegen dem ersten Augenschein. Und so geht es heute in Lingustikbüchern zu, Seite um Seite. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.10.2014 um 14.44 Uhr |
|
Implizites Wissen oder stilles Wissen (vom englischen tacit knowledge) bedeutet, vereinfacht ausgedrückt, „können, ohne sagen zu können, wie“. Jemand „weiß, wie es geht“, aber sein Wissen steckt implizit in seinem Können, ihm fehlen die Worte, um dieses Können zu beschreiben oder es anderen verbal zu vermitteln. Ein Beispiel dafür ist die Fähigkeit, auf dem Fahrrad das Gleichgewicht zu halten. Wer das vermag, kennt – aber eben nur implizit – eine komplexe physikalische Regel, die Neigungswinkel, aktuelle Geschwindigkeit, Kreiselgesetze und Lenkeinschlag berücksichtigt. (Wikipedia) Der Planimeter-Trugschluß in reinster Form. Ich wende beim Radfahren weder explizit noch implizit physikalische Regeln an. (Ich würde sofort umfallen.) Die neuronalen Vorgänge steuern ein Verhalten, das der Physiker unter Anwendung dieser Regeln erklären könnte. Der Neurologe würde niemals versuchen, die Regeln im Gehirn aufzufinden. Die Planeten kennen auch implizit die Keplerschen Gesetze nicht. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 10.10.2014 um 16.09 Uhr |
|
Das heißt, das Beispiel mit dem Fahrrad ist falsch. Aber kann es das überhaupt geben, ein Wissen, das man nicht in Worte fassen kann? Ich meine, nein. Das scheint mir gerade der Unterschied zwischen Wissen und Können zu sein. Was man nicht sagen kann, weiß man auch nicht. Man kann es eventuell. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 10.10.2014 um 16.18 Uhr |
|
Wobei in anderen Sprachen die Grenzen zwischen Wissen und Können anders verlaufen: « Je sais nager » und nicht « Je peux nager ».
|
Kommentar von Germanist, verfaßt am 10.10.2014 um 17.09 Uhr |
|
Das ist etwas, was einem Deutschen bei den slawischen Sprachen sofort auffällt: Das Modalverb "können" ist eingeschränkt auf körperlich imstande sein, alles andere heißt "wissen": Ich weiß zu schwimmen.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 10.10.2014 um 17.31 Uhr |
|
Wenn in anderen Sprachen das Wort Wissen mehrdeutig ist, dann muß man dort eben genauer eingrenzen, welche Art "Wissen" man meint. Wenn man aber im Deutschen von implizitem Wissen spricht, also von Wissen, das man nicht verbal beschreiben kann, dann ist sehr klar was damit gemeint ist, es ist ein Widerspruch in sich. Wissen hat mit Bewußtsein zu tun, stilles Wissen wäre also etwa unbewußtes Bewußtsein. Was jemand weiß, was ihm bewußt ist, jeden Gedankeninhalt, all das kann er auch mit Worten beschreiben. Man kann m. E. ohne Worte gar nicht denken, also auch nichts wissen. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 10.10.2014 um 18.26 Uhr |
|
Wissen ist eindeutig, savoir hingegen mehrdeutig? So einfach sollte man es sich nicht machen, sonst landet man geradewegs bei Heidegger.
|
Kommentar von Germanist, verfaßt am 10.10.2014 um 18.41 Uhr |
|
Im Deutschen sollte das Modalverb "können" öfter durch genauere Verben ersetzt werden, denn es kann 1.) körperlich imstande sein: "ich kann 10 km laufen" (ich schaffe das), 2.) geistig imstande sein: "ich kann das ausrechnen" ( ich weiß das), 3.) dürfen: "ich kann zuhause bleiben" (ich darf das) bedeuten.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 10.10.2014 um 23.15 Uhr |
|
Heidegger und sein Verhältnis zu wissen/können kenne ich zu wenig, um zu wissen und damit sagen zu können, warum es nicht ratsam wäre, seinen Standpunkt einzunehmen. Andere Bedeutungen von wissen (ähnlich wie bei savoir) gibt es zwar auch im Deutschen, er weiß sich zu benehmen/helfen oder er weiß zu gefallen, aber i. a. ist es doch eher auf etwas Gewisses als auf eine Fähigkeit gerichtet, was anscheinend bei der französischen Entsprechung viel beliebiger ist. Jemand kann "wissen wie es geht", wenn er jahrelang Physik und Medizin studiert hat, er kann jede Einzelheit des Fahradfahrens genau erklären, trotzdem wird er sich nach seinem Studium wackelig wie ein absoluter Anfänger zum ersten Mal in seinem Leben auf ein Fahrrad setzen. Er kennt also nicht nur implizit sämtliche physikalischen und medizinischen Geheimnisse des Fahrrades und seines Körpers, trotzdem kann er es nicht, muß die motorischen Fertigkeiten erst einüben. Es soll schon Schwimmlehrer gegeben haben, die selbst nie schwimmen konnten. Um diesen Unterschied zwischen dem Wissen/Kennen von bestimmten Fakten und Sachverhalten einerseits und dem Können (aufgrund einer Fähigkeit oder Erlaubnis zu etwas in der Lage sein) andererseits geht es doch hier (nicht um Unterschiede in verschiedenen Sprachen), und vor allem darum, ob ersteres auch in einer "stillen" Form vorkommt oder ob, wie ich meine, jedes Wissen verbal vermittelbar ist. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 10.10.2014 um 23.54 Uhr |
|
Heidegger hat als Sprachchauvinist ebenfalls die Verhältnisse im Deutschen verabsolutiert und andere Sprachen als nicht satisfaktionsfähig angesehen, was ihn allerdings nicht daran gehindert hat, Begriffe wie z. B. Dasein mit anderen Inhalten zu füllen oder mit Neologismen um sich zu werfen. Die Anmerkung war also ganz allgemeiner Natur und nicht auf den Fall wissen/können bezogen.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 11.10.2014 um 00.37 Uhr |
|
Die Frage, ob "stilles" Wissen existiert, ist meiner Ansicht nach in jeder Sprache formulierbar, und die Antwort muß in jeder Sprache sinngemäß gleich, und zwar 'nein' lauten. Der genannte Wikipedia-Artikel macht m. E. den Fehler, bestimmte, teils spontane Fähigkeiten und sogar Reflexe als Wissen zu bezeichnen. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 11.10.2014 um 14.29 Uhr |
|
Es ist wohl eine Frage der Definition. Was ist "Wissen"? Wenn ich darunter alle konkreten, verbal vermittelbaren Gedanken verstehe, erübrigt sich natürlich die Frage, ob es nicht verbal vermittelbares Wissen gibt. Wenn man andererseits, wie in Wikipedia, auch nicht verbalisierbare neuronale Bewegungen (Fähigkeiten, Reflexe) Wissen nennt, dann gibt es eben in diesem Sinne nicht verbal vermittelbares Wissen. Was wäre also eine vernünftige Definition? Ein anderes Wikipediabeispiel für implizites Wissen lautet: „Papa, warum sagt man eigentlich laufen/gelaufen, aber nicht studieren/gestudiert?“ Obwohl Herr Müller das zweite Partizip Perfekt ständig richtig bildet, kann er die Regel, die er implizit kennt, nicht verbalisieren. Was würde denn Herr Müller seinem Sohn antworten? Natürlich sagt er "Ich weiß es nicht" und nicht "Das weiß ich leider nur implizit". Er kennt die Regel auch nicht implizit. Was er wirklich weiß, ist, daß es studiert heißt, und das kann er seinem Sohn auch klar verbal vermitteln. Aber die Frage war ja "Warum?", und genau das weiß er eben nicht, und was er nicht weiß, kann er natürlich auch nicht verbalisieren. Nichtwissen als implizites Wissen zu bezeichnen ist doch unsinnig. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 12.10.2014 um 12.34 Uhr |
|
Der Eichelhäher und die Krähe haben gesehen, wo das Eichhörnchen seine Vorräte versteckt hat, und wissen es dann. Für eine Prüfung genügt es nicht, nur im wörtlichen Sinne eine "Vorlesung gehört" zu haben, man muß auch selbst Übungsaufgaben gelöst haben. Für das Wissen ist die verbale Mitteilung nur eine notwendige, aber noch nicht hinreichende Bedingung, es muß auch das Verstehen hinzukommen. Das Verstehen muß man sich selbst erarbeiten. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 12.10.2014 um 21.45 Uhr |
|
Lieber Germanist, ich bin nicht sicher, ob Sie mir damit zustimmen oder widersprechen möchten oder ob das mit meinen Bemerkungen nicht direkt zu tun hat. Was die Tiere "wissen", "wissen" sie das Ihrer Meinung nach explizit oder implizit? Da Tiere sich nicht verbal mitteilen können, soll das anscheinend ein Beispiel für implizites Wissen sein? Also ein Gegenbeispiel für mich? Ich habe geschrieben, daß alles Wissen auch verbal vermittelt werden kann, das heißt mit anderen (Ihren) Worten, die Fähigkeit zur verbalen Mitteilung ist eine notwendige Bedingung für Wissen. Dann sind wir also doch einer Meinung? Aber was ist dann mit dem Tierbeispiel? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.10.2014 um 04.29 Uhr |
|
"Mentale" Prädikate können auf zweierlei Weisen "mißbraucht" werden: 1. indem man sie auf Nichtpersonen (nichtdialogfähige) Wesen anwendet: Planeten, Computer, Ameisen... wissen, glauben, wollen... 2. indem man sie auf Teile der Person anwendet: das Gehirn weiß, glaubt, will, sucht... Diese beiden Irrtümer werden oft in einen Topf geworfen. Bennett/Hacker haben es klargestellt. Natürlich kann man im Alltag metaphorisch und metonymisch sprechen, das ist harmlos; anders in philosophischen und wissenschaftlichen Zusammenhängen. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 13.10.2014 um 15.59 Uhr |
|
Wenn man Tieren "Wissen" abspricht, muß man es vielleicht "Gedächtnis" oder "Erinnerung" nennen, wenn ein Hund jemanden nach längerer Zeit am Geruch wiedererkennt oder eine Katze sich erinnert, wo sie mal früher gut behandelt worden ist, oder ein Elephant sich gemerkt hat, wer ihn mal früher schlecht behandelt hat. (Ich habe nicht die Absicht, irgendjemanden anzugreifen.)
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 13.10.2014 um 18.07 Uhr |
|
Lieber Germanist, ich würde doch ein wenig Argumentation nicht als Angriff betrachten. Was soll uns denn nun das Beispiel sagen? Ich wäre ja durchaus bereit, eine gewisse Analogie in menschlichem und tierischem Wissen anzuerkennen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.10.2014 um 04.03 Uhr |
|
"To say 'the child who learns a language has in some sense constructed the grammar for himself' (Chomsky 1959:57) is as misleading as to say that a dog which has learned to catch a ball has in some sense constructed the relevant part of the science of mechanics." (B. F. Skinner: Contingencies of reinforcement. New York 1969:124)
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.11.2015 um 08.19 Uhr |
|
Wir halten es für selbstverständlich, daß wir selbst und andere „Vorstellungen“ im Kopf haben, woraus die Psychologen scheinbar wissenschaftlich „Repräsentationen“ machen. Aber diese Konstrukte (folkpsychologische Modelle) sind über Jahrtausende entwickelt worden, und es ist unrealistisch anzunehmen, daß sie sich bei unseren Kindern „entwickeln“. Vielmehr eignen sich die Kinder nach und nach die entsprechenden Redeweisen der Erwachsenen an, als Teil der Verhaltenskoordination, und interessant ist allenfalls, wann und in welcher Reihenfolge sie das tun und ob zum Beispiel Autisten dazu nicht imstande sind. Die mentalistische Psychologie leidet daran, daß sie die vermeintlichen Annahmen der Folk-Psychologie teilt, nur oft terminologisch ein wenig verfremdet. Manchmal kommt es uns vor, als ob wir in einem inneren Wörterbuch nachschlügen, und die Psychologen machen daraus ein „mentales Lexikon“. Damit erklärt man aber nichts, sondern handelt sich nur eine Menge unlösbare Schwierigkeiten ein. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.11.2015 um 08.11 Uhr |
|
„Niemand braucht die Regeln der Grammatik zu kennen, er muss sie beim Sprechen und Schreiben nur richtig anwenden.“ (Schmachthagen 24.11.15) Regeln, die man nicht kennt, kann man auch nicht anwenden. Man tut dann etwas anderes, was sich vom Betrachter als Regelanwendung darstellen oder simulieren läßt. Die Planeten wenden die Keplerschen Gesetze nicht an. Mentalisten sagen, im Kopf des Sprechers müsse es so etwas wie die Regeln geben, wenn auch natürlich nicht in der Art formuliert, wie wir sie kennen. Aber auch das ist unnötig und stört die Untersuchung der Wirklichkeit. Regeln gehören logischerweise zu einer Sprache, also zur Kommunikation, aber warum sollte irgendeiner Bewegung (Planetenbahnen, Artikulationsverhalten) etwas Kommunikatives zugrunde liegen? In den Computer werden keine Regeln eingebaut, sondern Schaltungen; das ist etwas ganz anderes. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.09.2017 um 18.52 Uhr |
|
Das Rindenmännchen im Gehirn bedeutet nicht, daß es dort ein Abbild des Körpers gibt. Ein Bild ist ein ganz bestimmtes Gebilde, das man betrachten kann wie eine Landkarte; ein Modell, mit dem man arbeiten kann, aber hier geht es einfach um Zuständigkeiten bei der Verarbeitung von Impulsen zum Zwecke bestimmter Verhaltensweisen. Der Körper ist im Rindenmännchen nicht „repräsentiert“, weder im sensorischen noch im motorischen Kortex.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.02.2018 um 10.07 Uhr |
|
Neben die „Codierungsprozesse“ des Sprechers und Schreibers treten – informations- und kommunikationstheoretisch gesprochen – die „Decodierungsprozesse“ des Hörers und Lesers als spezifische Aktivitäten der Person. (Friedrich Kainz in Luchsinger/Arnold 2. Aufl. 274) Eben nicht. Der Code-Begriff der Informationstheorie hat nichts mit der laxen Alltagsrede vom „Code“ zu tun. Kainz greift der wirklichen Einsicht vor, wenn er impliziert, wir könnten Sprechen und Verstehen in diesen technischen Begriffen analysieren, womit übrigens zusätzlich das hochproblematische Postulat einer Gedankensprache verbunden wäre, aus der und in die übersetzt wird. (Verräterisch ist schon die seltsame Ausdrucksweise: „Codierungsprozesse des Sprechers“ usw., und diese Prozesse sollen zugleich „Aktivitäten der Person“ sein.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.02.2018 um 15.47 Uhr |
|
„The writer converts the abstract concept he has created into a linguistic form. This operation is usually called encoding.“ (Juan C. Sager in Hartmut Schröder (Hg.): Subject-oriented Texts. Berlin, New York 1991:245) Man weiß zwar nichts, drückt es aber sehr wissenschaftlich aus. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.02.2018 um 15.57 Uhr |
|
„Encodieren und Decodieren sind Übersetzungsvorgänge – in die Sprache und aus der Sprache.“ (Hans Hörmann: Psychologie der Sprache. Berlin 1977:21) Und zwar aus welcher Sprache und in welche Sprache? Wer das nicht sagt, sagt eigentlich gar nichts. Wie ist es möglich, daß so viele intelligente Menschen nicht bemerken, daß zum Übersetzen immer ein Paar von Sprachen gehört? Es genügt auch nicht, Übersetzen in Anführungszeichen zu schreiben oder als Metapher zu bezeichnen. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 28.02.2018 um 19.29 Uhr |
|
Lacan hat es ja irgendwie gemerkt und kurzerhand das Unbewußte für sprachlich strukturiert erklärt. Aber warum nur das Unbewußte? Wohl aus beruflichen Gründen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.03.2018 um 03.48 Uhr |
|
Saussure spukt immer mit. Dann auch der semiotische Imperialismus in der Peirce-Nachfolge. Sichtbare Folge ist die Aufblähung auf vier Bände in der HSK-Reihe.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.03.2018 um 07.43 Uhr |
|
Die Homunkulus-These steckt in vielen Theorien, deren Vertreter sich dessen gar nicht bewußt sind. Überall, wo mentale Sprachen, "Begriffe", Repräsentationen, "Karten" (maps) usw. beschworen werden, gehört ein Männchen dazu, das mit ihnen umzugehen versteht. Vielleicht haben wir ein solches Männchen im Kopf oder im "Geist". Ich versuche nicht, es zu widerlegen, aber ich gehe dem Gedanken auch nicht weiter nach. Die Hypothese ist nämlich nutzlos. Sie kann das Verhalten nicht erklären, weil das Verhalten des Homunkulus seinerseits erklärt werden müßte (Skinners Hauptargument). Dennett versuchte sich aus der Affäre zu ziehen, indem er immer dümmere Homunkuli hintereinander schaltete. Aber wie Geert Keil gezeigt hat, sind auch extrem dumme Homunkuli immer noch welche. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.05.2018 um 04.43 Uhr |
|
Mentalistic explanations are homuncular. Skinner in a number of places objects to mentalistic explanations that they in effect invoke a little person or homunculus with all the same abilities that the ordinary person has. "The inner man is regarded as driving the body very much as the man at the steering wheel drives a car". Explaining the behavior of a person by appealing to a little person inside the head, "driving" the body, clearly does not accomplish anything, since the actions of the homunculus are just as much in need of explanation as the actions of the person were originally. (http://www.trinity.edu/cbrown/mind/behaviorism.html) In Theo Herrmanns Sprachpsychologie ist der Homunkulus durch behördenähnliche Instanzen ersetzt, was an der Sache nichts ändert. Freuds Psychologie ist auch eine Homunkulus-Psychologie (vgl. Jacques Van Rillaer in: Anton Leitner/Hilarion Petzold, Hg.: Sigmund Freud heute: Der Vater der Psychoanalyse im Blick der Wissenschaft und der psychotherapeutischen Schulen. Wien 2009:179) Beide durch ihre Nähe zur Alltagspsychologie attraktiv für unkritische Geister. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 10.05.2018 um 20.16 Uhr |
|
Selbstverständlich führt die Homunkulus-These sich selbst zum Widerspruch, aber das bedeutet nicht, daß die mentalistische Verhaltenserklärung falsch ist. Diese verlangt überhaupt keinen Homunkulus! Den Homunkulus führen Gegner der mentalistischen Anschauung als Hilfsmodell ein, weil sie nicht für möglich halten, daß ein lebendiger Informationsspeicher sich selbst steuern und ab einer gewissen Evolutionsstufe sich seiner selbst bewußt werden kann. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 10.05.2018 um 21.18 Uhr |
|
Manche Mentalisten mögen sich ungeschickt ausdrücken, aber das bedeutet nicht, daß die gesamte Theorie auf Homunkuli basiert.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.05.2018 um 05.05 Uhr |
|
Es geht darum, ob in einem Erklärungsmodell, das Anschluß an die Naturwissenschaft finden kann, das "intentionalistische" oder eben mentalistische Vokabular vorkommen darf. Ein Modell, das Absichten, Voraussagen, Bewußtsein usw. enthält, ist von vornherein nicht in natürlichen Begriffen interpretierbar, und dies wird ja seit Brentano sogar noch als auszeichnendes Merkmal des Psychischen gefeiert. Der Homunkulus ist nur ein Kürzel für die mentalistische Begrifflichkeit, eben die Zuschreibung von persongebundenen Merkmalen an eine subpersonale Instanz. (Vgl. Dennetts "intentional stance" – gut herausgearbeitet, mit falschen Schlußfolgerungen, aber das will ich hier nicht ausführen, Dennett ist ein Fall für sich.) Und noch einmal: Es geht in meinen Augen nicht um das Zu- oder Absprechen von Bewußtsein, sondern darum, wie es zum Reden von "Bewußtsein" gekommen ist und wie dieses Reden funktioniert. Ganz direkt gefragt: Wie kommt es, daß Manfred Riemer sich auf das Bewußtsein beruft? Woher hat er dieses Konstrukt und wozu benutzt er es? Und schließlich: Wie kommt es, daß Theodor Ickler zwar ständig in Versuchung ist, es ebenso zu halten, sich aber der Versuchung sprachkritisch widersetzt und nur eine nichtmentalistische Wissenschaft anerkennen will? Diese "persönliche" Fassung des Problems schlage ich nicht aus Jux vor, sondern weil es tatsächlich zuletzt immer um das geht, was ich "Letzte Gewißheit" nenne und mit Zitaten von Brentanos locus classicus bis heute belegt habe. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.05.2018 um 09.49 Uhr |
|
Die Grammatik einer Sprache ist die Repräsentation des Wissens, das die grammatische Kompetenz ausmacht, d.h. die Fähigkeit, beliebige Äußerungen wohlgeformt zu bilden oder als (nicht-) wohlgeformt zu erkennen und mit anderen Kenntnissystemen zu verküpfen. (...) Das Wissen, über das der muttersprachliche Sprecher souverän verfügt, ist ihm aber introspektiv unzugänglich. Es ist kognitiv opak und kann auf Befragen nicht genannt werden. Chomsky lenkte als erster mit methodischer Konsequenz den Blick auf die Frage, wie der Sprecher zu diesem Wissen gelangen könne. Weil er als erster einen kleinen Linguisten im Kopf des Sprechers annahm. Für andere gibt es diese Frage gar nicht, sie halten Sprache für ein gelerntes Verhalten wie jedes andere. Sie halten die Intellektualisierung des Könnens als "Wissen" für unnütz und schädlich. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.05.2018 um 05.08 Uhr |
|
Viele Psychologen meinen, die grundsätzliche Ausscheidung der Selbstbeobachtung sei methodologisch und aus Gründen der Zweckmäßigkeit nicht vertretbar. Tatsächlich ist ja die „Welt für jeden Einzelnen“, d. h. die Welt, so wie der Einzelne sie erlebt (seine „Eigenwelt“) von hohem wissenschaftlichem Interesse. Sie sei aber nur über die Vermittlung von Sprache, mimischem Ausdruck usw. zugänglich: Die „Eigenwelt“ des anderen Menschen kann aus seinen Äußerungen lediglich erschlossen werden; sie hat aber insofern Konstruktcharakter. (Theo Herrmann: Lb. der emp. Persönlichkeitsforschung. Göttingen 1974:40) Außerhalb und vor jeder wissenschaftlichen Besinnung pflegt der Mensch sich selbst und seine Mitmenschen als einzigartig und unverwechselbar zu erleben. Menschen haben ihr je eigenes, individuelles Selbstbild (self concept). (...) Da also die Einzigartigkeit als geäußertes Erlebnis beobachtbarer Menschen ein empirischer Sachverhalt ist, ist sie ein legitimer Gegenstand empirischer Persönlichkeitsforschung. (Ebd. 44) Hier fehlt die semiotische Analyse einer Redeweise, die so verstanden wird, als wäre sie ein Bericht über Erlebnisse. Das „geäußerte Erlebnis“ ist kein empirischer Sachverhalt, sondern zunächst einmal eine Äußerung und als solche erklärungsbedürftig, wie die ganze pseudoreferentielle („transgressive“) Erlebnissprache. Das Selbstbild ist ja nicht einfach gegeben, sondern in die heutigen Menschen „hineingeredet“. Tausende Generationen hätten mit dem Begriff nichts anfangen können, und heute soll es schlicht gegeben und eine letzte Gewißheit sein? Wenn die Eigenwelt aus den Äußerungen „erschlossen“ wäre, dann wäre sie nach Herrmanns eigenen Begriffen gerade kein Konstrukt, sondern eine hypothetische Einheit. Ein Konstrukt ist eine nützliche Fiktion und wird nicht „erschlossen“. Der Verfasser kann sich nicht entscheiden, ob er an die Existenz einer „inneren Welt“ glauben soll oder nicht. Den Standpunkt der reinen Verhaltensanalyse, der sich von der vermeintlichen „Weisheit der Sprache“ (ebd.) emanzipiert, wird er später besser herausarbeiten, ohne ihn jedoch je einzunehmen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.07.2018 um 14.53 Uhr |
|
Das berühmte Gefängnis-Experiment vom oben erwähnten Philip Zimbardo (Stanford-Prison-Experiment), das schon immer kritisiert worden war und nie repliziert werden konnte, scheint nun endgültig als Humbug entlarvt zu sein. Da spukt noch manches durch die psychologische Literatur. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.11.2018 um 05.54 Uhr |
|
Auch zu: http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1548 Die geisteswissenschaftliche (phänomenologische, hermeneutische, „verstehende“) Psychologie ist ein Zweig der Philosophie und wurde folgerichtig lange Zeit von philosophischen Lehrstühlen aus betrieben. Sie betrachtet die folk psychology nicht als zu erforschenden Gegenstand, sondern als ihre Grundlage und ihren Ausgangspunkt und betreibt deren „Kultivierung“, wie ich es nenne, d.h. den Ausbau der Erlebnissprache mit ihren mentalistischen Konstrukten. Ihre Plausibilität bezieht sie nicht aus Experimenten, sondern aus dem ständigen Appell an den Laien. Dazu gehören rhetorische Mittel: Wer möchte schon ein „Automat“ sein, der „passiv“ auf Reize reagiert usw.? Die Psychologie soll ausdrücklich menschenfreundlich sein („human“, „menschlich“, „wohltuend“, so Norbert Groeben/Diethelm Wahl/Jörg Schlee/Brigitte Scheele: Forschungsprogramm Subjektive Theorien. Eine Einführung in die Psychologie des reflexiven Subjekts. Tübingen 1988). Es gibt viele Versuche, beide Forschungsrichtungen zu versöhnen, aber dabei kommt es immer zu „hybriden Begriffssystemen“, vgl. Th. I.: „Hybride Begriffssysteme als semiotisches Problem (am Beispiel psychologischer Sprache)“. In: Peter R. Lutzeier (Hg.): Studien zur Wortfeldtheorie. Tübingen 1993:269-278. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.01.2019 um 05.46 Uhr |
|
Der Eintrag http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1548#36238 war etwas unvermittelt eingefügt, denn der "Homunkulus" der Neuroanatomie, das berühmte Rindenmännchen, hat nichts mit dem philosophischen Homunkulus zu tun, auch wenn manche hier eine Bestätigung zu sehen glauben. Wikipedia handelt die "Projektionen" der sensorischen und motorischen Nervenbahnen in den Gyrus post- bzw. praecentralis unter dem Gesamttitel "Homunkulus" ab. „Das Gehirn kann also allein aus der aktivierten Zellgruppe im Cortex schlussfolgern, in welchem Körperabschnitt der Schmerz auftritt.“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Homunkulus#Homunkulus_in_der_Neuroanatomie) Das Gehirn schlußfolgert nicht. Wieder die falsche Begrifflichkeit, als betrachte jemand das vermeintliche "Abbild" der Welt im sensorischen Kortex. Aber die Abbildung oder vielmehr Projektion besteht nur in der somatotopen Steuerung des Verhaltens, es gibt nicht zusätzlich noch jemanden (eben den philosophischen Homunkulus), der das "Abbild" auswertet, wie man eine technische Zeichnung oder eine Landkarte liest und auswertet. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.11.2020 um 07.34 Uhr |
|
Zur Diskussion über wissen/kennen und tacit knowledge. Vielleicht hat es doch zur Diskussion beigetragen, daß es im Englischen keine synonymische Differenzierung von wissen/kennen gibt, sondern gerade umgekehrt eine Disambiguierung von know (oft an Russell anschließend). Im Chinesischen unterscheidet man heute zhī dào „wissen" (eigentlich "den Weg kennen“) und rènshi „kennen“. Eine Verwechslung ist nicht vorstellbar. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.05.2021 um 12.37 Uhr |
|
Es gibt eine sinnlose Diskussion, ob das Zielwort „passiv aktiviert“ wird (priming) oder ob man eine „aktive Suche nach einem bestimmten Wort“ annehmen muß (z. B. bei Angela Friederici: Neuropsychologie der Sprache. Stuttgart 1984:49). Es fällt mir ein oder ich suche danach. Aber das Suchen ist wieder ein anderes Verhalten, hier handlungsbegrifflich modelliert. Auch das Suchen fällt mir ein, und jeder einzelne Schritt dabei fällt mir irgendwie ein. Auch das Planen ist ungeplant, die Absicht entsteht unabsichtlich. Das gesellschaftliche Konstrukt der Person (des Handelnden) wird naturalistisch als Verhalten erklärt, mentalistisch umgekehrt das Verhalten als Handlung einer Person, also eines Homunkulus. Neisser schreckt nicht davor zurück, einen Homunkulus anzuerkennen, der die „Konstruktion“ steuert (s. Kurt Salzingers Rezension). Die kognitive Psychologie entspricht dem Kreationismus, der Homunkulus dem Schöpfer. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.05.2022 um 06.39 Uhr |
|
Menschen „haben gelernt, Y zu tun, wenn die Bedingung X vorliegt. Und es liege X vor. Also tun sie Y. Dieser Vorgang folgt offensichtlich einem ‚psychologischen Syllogismus‘.“ (Theo Herrmann: Allgemeine Sprachpsychologie. Grundlagen und Probleme. 2. Aufl. Weinheim 1995:58) Auch als technischer Regelkreis zu modellieren (59). Das Apfelpflücken wird dadurch ausgelöst (ausgewählt), daß das UOS [„Umgebungsrepräsentations- und Operatorenauswahlsystem“] die Informationen hat, daß Apfelhaben vor Apfelnichthaben präferiert wird und daß der Apfel nicht gehabt ist. (Also das Schema von Absicht und Einsicht, Intention und Kognition usw., das jedes Verhalten scheinbar erklärt.) „Die soeben betrachtete Auslösung eines Sprachproduktionsvorgangs war in bestimmter Weise durch eine im Sprechersystem repräsentierte Konvention geleitet; sie folgte dem allgemeinen Schema: Gesollt ist ein bestimmtes eigenes Verhalten, wenn ein bestimmtes partnerseitiges Verhalten vorliegt, und dieses partnerseitige Verhalten liegt vor.“ (Hermann/Grabowski: 274) Ich sehe in solchen Formulierungen nur eine stark verfremdete Darstellung konditionierten Verhaltens: Gegrüßtwerden erhöht aufgrund von Lernen die Wahrscheinlichkeit eines Verhaltens, das als „Wiedergrüßen“ gilt. „Konvention“, „Gesolltes“ usw. haben in einer Verhaltensanalyse eigentlich nichts zu suchen und in einer Analyse, die dem das Verhalten erzeugenden Apparat (System, Organismus) gilt, natürlich noch viel weniger. Schon bei Tauben oder Ratten wirkt der praktische Syllogismus lächerlich. Tauben haben gelernt, auf eine Scheibe zu picken, wenn ein rotes Licht aufleuchtet. Das Licht leuchtet auf, also... Spinnen fangen Fliegen, Amöben meiden Säure. Es ist ganz leicht, dem einen praktischen Syllogismus unterzuschieben. Einen Wissenschaftler sollte es schaudern, wenn er hört: „Umgebungsrepräsentations- und Operatorenauswahlsystem“. Man kann es „formalisieren“ (abkürzen) und in Schaltbilder einfügen, aber es bleibt pseudokybernetischer Humbug. Das Mannheimer Modell der Sprachproduktion ersetzt den traditionellen Homunkulus durch eine Behörde. Theo Herrmann wußte das, traute sich aber nicht, sein jahrzehntelang gepflegtes Modell aufzugeben und damit auch die Qualifikationsarbeiten seiner zahlreichen Schüler (auch seiner Freunde wie Levelt) zu Altpapier zu machen. Wie kommt man von der Conclusio des psychologischen oder praktischen Syllogismus zum Verhalten selbst? Das ist ja nicht trivial. Das „Gesollte“ (nach Herrmann) wird nicht automatisch zu einem Getanen. Ein Satz, auch eine Aufforderung, ist zunächst eine Lautkette. Deren praktische Folgen müssen doch auch konditioniert worden sein usw. (infiniter Regreß). Also kann man sich das logisierende Zwischenstück der „Syllogismen“ auch sparen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.10.2023 um 11.30 Uhr |
|
Dawkins kennt die Gefahr der Homunkulus-Deutung innerer Modelle (Unweaving 283). Aber er bleibt bei der angeblich nützlichen Redeweise, daß die Fledermaus, die Schwalbe und auch der Mensch ein inneres Modell „benutzen“ (use), um sich zu orientieren, d. h. ihre Bewegungen zu steuern. Weiter will er nicht gehen: „Somehow the model is used to control the wing muscles, and that is as far as I go.“ Aber selbst damit geht er zu weit. Es gibt keinen Betrachter innerer Bilder, das sagt er selbst im Anschluß an Dennett. Aber es gibt aus dem gleichen Grund auch niemanden, der hier etwas „benutzt“. Die Fledermaus oder die Schwalbe selbst als Subjekt einzusetzen ist zweifellos unzulässig. Teils angeboren, teils gelernt paßt sich der Organismus an die Umgebung an. Manche Bewegungen sind möglich, andere nicht, einige führen zum Erfolg, andere nicht. Man beachte das charakteristische „somehow“ in der zitierten Formulierung. Es ist das bekannte Signal der Sackgasse, in die sich diese Philosophie am Ende stets verrennt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.10.2023 um 14.17 Uhr |
|
"Zweifel an dem Gewaltexperiment der 1970er-Jahre" Doch nicht jetzt erst! Vgl. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1548#39099 |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 31.10.2023 um 06.29 Uhr |
|
Wie im Haupteintrag reichlich belegt (ich könnte noch mehr anführen), finden die Kognitivisten nichts dabei, von "aktiven Prozessen" und "passiven Akten" zu reden, und mit diesem Rüstzeug glauben sie dann, gegen den viel methodenbewußteren Behaviorismus antreten zu können. Den darin verborgenen Homunkulismus braucht man aber gar nicht aufzudecken. In einem der Gründungswerke des Kognitivismus heißt es ausdrücklich: „Who does the turning, the trying, and the erring? Is there a little man in the head, a homunculus, who acts the part of the paleontologist vis-à-vis the dinosaur? Unpalatable as such a notion may be, we can hardly avoid it altogether. If we do not postulate some agent who selects and uses the stored information, we must think of every thought and every response as just the momentary resultant of an interacting system, governed essentially by laissez-faire economics. Indeed, the notions of ‘habit strength’ and ‘response competition’ used by the behaviorists are based on exactly this model.“ (Ulric Neisser: Cognitive psychology. New York 1967:279) Damit ist die kognitive Psychologie als Homunkulus-Psychologie definiert und gerechtfertigt. "Mind is back!" – in der Tat. ("The ghost in the machine" war eine weniger erhabene Formel.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.02.2024 um 06.16 Uhr |
|
Propositionales Wissen: Woher weiß ich, daß Paris die Hauptstadt von Frankreich ist und Spinnen acht Beine haben? Es ist eine Mischung von intraverbalen Reaktionen (nach Skinners Ausdruck), also sprachlichen Mitteilungen, und eigener Beobachtung. Diese vergangenen Erfahrungen ermöglichen es mir, die betreffenden Aussagesätze hervorzubringen, eine sprachliche Fertigkeit, die aber nicht zu dem unausdenkbaren Schluß berechtigt, in mir seien Aussagen gespeichert. „Propositionale Speicherung“ sollte von ihren Vertretern erst einmal so definiert werden, daß eine (neurologische) Ratifizierung überhaupt denkbar erscheint. Aussagen und ihre logische oder mentale Dublette Propositionen gehören nun einmal zu sprechenden, dialogfähigen Wesen, und zwar jeweils mehreren davon, damit sie mit Zuspruch und Einspruch darauf reagieren können. So jedenfalls unser gewöhnliches Verständnis. Wenn es etwas ganz, ganz anderes sein soll, dürfen wir wohl eine Erklärung erwarten.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 29.02.2024 um 13.22 Uhr |
|
Ich glaube, daß im Gehirn Aussagen gespeichert werden, sagt so direkt niemand, es wäre ja auch absurd. Also kommt man auf den verschwommenen Begriff Proposition. Was ist das? Einerseits sollen es nur Bedeutungen sein, man will sich damit gegen ganz konkret formulierte Aussagen abgrenzen, andererseits wird den Propositionen aber auch ein Wahrheitswert zugesprochen, d.h. irgendwie sind es dann doch Aussagen, Sachverhalte, nur nicht so eindeutig formuliert. "Mentale Dublette" einer Aussage finde ich gut, und darum empfinde ich es auch als ebensolchen Unsinn, von gespeicherten Propositionen zu sprechen. Ich möchte Ihr Beispiel von den Jahresringen eines Baumes aufgreifen. Ist im Baumstamm in irgendeiner Form einer der Sätze "Dieser Baum ist 50 Jahre alt" oder "Vor 50 Jahren ist dieser Baum gekeimt" kodiert? Nein. Ist in irgendeiner Form die Bedeutung dieser Baum/Entstehungsdatum/vor 50 Jahren enthalten? Nein. Was hat der Baum dann? Er hat sichtbar unterschiedliche, ringförmig angeordnete Holzarten, also Information. Weiter erstmal nichts! Daraus läßt sich nun, allerdings nur, wenn man weiß, wie ein Baum entsteht, lebt und wächst, weitergehende Information ableiten, d.h. die ursprüngliche Information (Ringe) wird interpretiert. So entstehen dann Propositionen bzw. Aussagen. Ebenso wird die physische Beschaffenheit des Gehirns bzw. die darin enthaltene Information vom Menschen (dem Gesamtorganismus, keinem Homunkulus) interpretiert. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.02.2024 um 17.51 Uhr |
|
In vielem stimme ich zu, aber: "Holzarten, also Information" und: "Information (Ringe)"? Diese Gleichsetzung ist mir so unverständlich wie seit je. Holzarten sind Holzarten, und Ringe sind Ringe. Man kann was daraus machen, Stühle zum Beispiel, oder eben Theorien (Informationen im landläufigen Sinn) über die Vegetationsgeschichte. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 04.03.2024 um 01.55 Uhr |
|
Ich würde sagen, darin stimmen wir nun genau überein: Man macht Stühle aus dem Holz und Information im landläufigen Sinne aus den Ringen. Auf das Wort Information (für die Ringe) kommt es gar nicht an, wesentlich ist ja nur, daß die Aussage bzw. Nachricht (= die "landläufige Information") in den Ringen schon ihre Grundlage, ihren Ursprung, ihre Rechtfertigung hat, daß sie also darin bereits äquivalent angelegt ist. Ohne die Ringe gäbe es sie nicht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.03.2024 um 04.37 Uhr |
|
Jede (wahre) Aussage hat eine Grundlage in ihrem Gegenstand, das ist mir zu unspezifisch. Ob Sie es Information nennen oder mit drei anderen Synonymen umstellen – sehen wir doch lieber hin, was wirklich geschieht, wenn wir die Welt erkennen und unsere Erkenntnis mitteilen! Gestern habe ich an Sie gedacht, lieber Herr Riemer, als ich an einem Waldweg die großen Mengen frisch geschnittener Kiefern liegen sah und mir die Jahresringe genauer ansah. Am liebsten hätte ich der Enkelin erklärt, was ich darüber weiß, aber sie ist noch zu klein. Die Baumstämme haben mir jedenfalls keine Nachricht gesendet, außer im poetischen Sinn. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 04.03.2024 um 23.19 Uhr |
|
Nicht eine Grundlage, sondern die Grundlage, ihre Grundlage. Der reale Bezugsgegenstand ist (im Falle einer Aussage über die reale Welt) sozusagen der Wahrheitstest. Deshalb spreche ich auch von Äquivalenz. Das ist unspezifisch?
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.05.2024 um 07.03 Uhr |
|
Was John S. Kennedy (The new anthropomorphism. New York 1992) als „Anthropomorphismus“ kritisiert, fällt für mich teilweise unter „Homunkulismus“, nämlich immer dann, wenn es darum geht, das Innere des Menschen als personhaft zu modellieren. „Anthropomorphismus“ ist dagegen die Vermenschlichung von Tieren (manchmal auch von anderen natürlichen Gegebenheiten oder sogar Maschinen). Die laxe metaphorisch-anthropomorphisierende Redeweise, die sich fast alle Biologen erlauben, weil die Darstellung sonst zu pedantisch und umständlich würde, nennt Kennedy „mock anthropomorphism“, bezweifelt aber mit Recht, daß die Biologen sich der Metaphorik stets bewußt sind.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.05.2024 um 04.16 Uhr |
|
Zum vorigen: Die Metaphorik ist, wie hier schon öfter zu kritisieren war und auch von Kennedy bemerkt wurde, durch häufigen Gebrauch von Anführungszeichen gerade um die zentralen Begriffe gekennzeichnet. Oft fehlen sie aber auch, so daß der Leser nicht weiß, ob der Anthropomorphismus (Dennetts „intentionaler Standpunkt“) nicht doch mehr als eine heuristisch nützliche Fiktion ist. Da evolutionäre Anpassung und menschliches Handeln es mit ähnlichen Aufgaben zu tun haben, sehen auch die Lösungen so aus, als ob sie Ergebnis einer bewußten Planung wären. Das sollte nicht überraschen (John S. Kennedy: The new anthropomorphism. New York 1992:93). Mit einem solchen Als-ob kann sich aber die Wissenschaft nicht begnügen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.05.2024 um 04.41 Uhr |
|
Mit dem Begriff des Willens ist gegeben, daß man auch etwas tun kann, was man nicht will. Dazu ein bekanntes Sophisma: Wenn ich mich zu etwas überreden lasse oder mich selbst überrede (wie man sagt), was ich („eigentlich“) nicht will, muß ich es doch wenigstens im Augenblick wollen, sonst würde ich es nicht tun. Aber wenn alles, was man tut, gewollt wäre und alles, was man will, auch getan würde, gäbe es den Begriff gar nicht. Bei einer objektiven, nicht-anthropomorphisierenden Beobachtung der Tiere stellen wir dieses Auseinanderklaffen von Absicht und Verhalten nicht fest. Erst die Sprache ermöglicht den Deliberationsdialog, wie unter „Naturalisierung der Intentionalität“ beschrieben, und damit die Aufspaltung in Vorsatz (Plan, Absicht) und Ausführung. Auch bei Suchtverhalten sagt man, jemand wolle langfristig abstinent sein, schaffe es aber kurzfristig nicht. „Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.“ (Matthäus 26,41) „Video meliora proboque deteriora sequor.“ (Ovid: Metamorphosen VII, 20f.) – Warum wollen und tun wir nicht, was in unserem eigenen Interesse ist? Dieses Problem hat die Philosophen spätestens seit Sokrates beschäftigt. Vgl. Skinner: „An operant analysis of problem solving“ (Behavioral and Brain Sciences 7/1984:583-591. Oft abgedruckt, auch in Catania/Harnad als eine der „kanonischen Schriften“). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.05.2024 um 05.02 Uhr |
|
Das Ziel kann das Verhalten nicht steuern, weil dies die zeitliche Folge von Ursache und Wirkung umkehren würde. Wenn aber die Vorstellung des Ziels das Verhalten steuert, stimmt die natürliche Folge wieder. (Kennedy 29f.) Dagegen läßt sich u. a. einwenden: Es ist schwer, solche angenommenen Vorstellungen oder Bilder (images) als steuernd im biologischen Sinn aufzufassen. Der Schritt vom Bild zum Verhalten wird nicht erklärt und kann darum auch nichts erklären. Auch Wissen „steuert“ nicht in diesem Sinn. Das sind keine Tatsachenfragen. Die Rede von Wissen, Bildern, Vorstellungen gehört einer anderen Sprache an als die Rede vom Steuern; man redet unvermerkt metaphorisch, wenn man sagt, das Wissen, das Bild „steuere“ das Verhalten. Das Entstehen der Bilder muß auch noch erklärt werden. Woher kommen Vorstellungen (falls es sie gibt und was immer sie sein mögen)? Wenn man sich ein Bild vom Ziel machen kann, dann kann man auch gleich das Verhalten auf das Ziel ausrichten. Die Herstellung des Bildes vom Ergebnis und die Herbeiführung des Ergebnisses sind nicht wesentlich verschieden: Mach dir ein Bild vom fertig gedeckten Tisch! Deck den Tisch! Das sind Handlungen gleicher Art. Ein Problem erst im Geist zu lösen (mentales Probehandeln) ist ebenso erklärungsbedürftig wie die wirkliche Lösung – und um ein Vielfaches schwerer erklärbar, weil es im Niemandsland eines angenommenen Geistes stattfinden soll, wo man es nicht beobachten kann. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 26.05.2024 um 15.27 Uhr |
|
Die Rede von der Steuerung des Verhaltens durch das Ziel oder durch das Wissen (Bild, Vorstellung usw.) ist m. E. sowieso verfehlt. Es wird ja öfters auf den mereologischen Trugschluß hingewiesen: Nicht ein einzelnes Teil oder Organ steuert, sondern der Mensch. Zwar bin ich der Ansicht, daß dieser Trugschluß oft in recht wortklauberischer Weise hervorgeholt und strapaziert wird, man muß nicht ständig, wenn der Sinn klar ist, darauf hinweisen, daß das Einzelteil nicht die Funktionalität des Ganzen hat. Aber hier, wo es wirklich vorrangig um Ziel, Wissen, Bild usw. geht, würde ich nicht sagen, daß sie steuern, sondern daß sie die Steuerung mit beeinflussen. Es mutet mich seltsam an zu sagen, ein bestimmtes Bild oder Ziel steuere mein Verhalten. Ich habe ja viele Bilder, Vorstellungen, auch konkurrierende Ziele, ich bewerte dies alles und treffe danach meine Entscheidung. Ich steuere also. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.05.2024 um 04.24 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1548#53277: Verwandt ist Nicolai Hartmanns sophistische Darstellung von Möglichkeit und Wirklichkeit: Alles, was möglich ist, ist auch wirklich, denn sonst würde etwas zur Möglichkeit fehlen. Man kann hier mit Kennedy den Anthropomorphismus aufspüren, der im Begriff der Möglichkeit versteckt ist. In der Natur gibt es kein Sein-„Können“. Der Begriff der Möglichkeit ist aus der intentionalen Sprache in die „Ontologie“ (wie er es nennt) übertragen. Das Ergebnis sind viele tausend Seiten Unsinn, schlechte Philosophie am Leitfaden der Sprache. Ich habe als Schüler, während ich auf Empfehlung meines Deutschlehrers einige dicke Bücher von Nicolai Hartmann durchlas (unfaßbar aus meiner heutigen Sicht), gespürt, daß etwas nicht stimmt, war aber noch weit davon entfernt, es zu durchschauen und in Worte zu fassen. Meine jugendlichen Verirrungen (Phänomenologie, Psychoanalyse) haben mich viel Zeit gekostet, aber ich blicke mit Nachsicht darauf zurück, und das macht mich auch nachsichtig mit anderen Menschen, die – wie es der Zufall will – dieser oder jener Irrlehre anhängen. Weniger nachsichtig bin ich, wenn sie dabei bleiben, statt sich irgendwann zu fragen: Stimmt denn das überhaupt? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.07.2024 um 04.47 Uhr |
|
Man kann optische Täuschungen wie die „Kraterillusion“ (auch „dot illusion“, https://arxiv.org/pdf/2405.12998) als unbewußte Schlußfolgerung im Sinne Hermann von Helmholtz’ rekonstruieren: „Major premise: A shade on the upper part of a dot is nearly always associated with a concave shape. Minor premise: The shade is in the upper part. Unconscious inference: The shape of the dot is concave. Our brains assumes a three-dimensional world, and the major premise guesses the third dimension from two ecological structures: 1. Light comes from above, and 2. There is only one source of light.“ (Gerd Gigerenzer: „Unconcscious inferences“. In John Brockman, Hg.: This explains everything. New York u. a. 2013:55-58, S. 56, auch hier: https://www.edge.org/response-detail/10594) Abgesehen von der unzulässigen Einführung des Gehirns (ein Gehirn nimmt nichts an usw.) ist das Ganze eine Intellektualisierung organischer Strukturen und Vorgänge nach Art des Planimeter-Trugschlusses. Logisches Schließen ist eine besonders disziplinierte Form von Sprachverhalten, also etwas Gesellschaftliches, Kulturelles. Natürlich kann man nicht streng beweisen, daß in Mensch und Tier nicht ständig ein logisches Schließen (in einer unbekannten Sprache des Geistes) stattfindet, aber die Beweislast liegt bei jenen, die solche überflüssigen Spekulationen anstellen. Und überflüssig sind sie, weil wir Geräte bauen können, von denen wir mit Sicherheit wissen, daß sie keine Schlüsse ziehen: Thermostaten, Planimeter, Computer... |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.07.2024 um 06.28 Uhr |
|
Ratten können nicht sprechen, aber ihr Geist bzw. ihr Gehirn kann es. Jedes angepaßte Verhalten läßt sich so darstellen, ALS OB es das Ergebnis von logischem Schlußfolgern sei. Das kann man dann auch in eine ordentliche logische Form (Prädikatenkalkül) bringen. So wird die „Sprache des Geistes“ rehabilitiert. Der Fehler besteht darin, eine Sprache des Geistes, die einen ganz anderen Ursprung hat, für eine Tatsachenfrage der Neurologie zu halten. Eigentlich sollte die Wissenschaft darüber hinaus sein, aber es wird immer wieder versucht: Nina Kazanina/David Poeppel: „The neural ingredients for a language of thought are available“. Trends in cognitive sciences 27/2023:996-1007. Die von Philosophen postulierte Sprache des Geistes kann keine neuronalen Bestandteile haben. Die Suche danach kommt nie zu einem Ergebnis – oder immer, was ebenso fatal ist.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.10.2024 um 19.09 Uhr |
|
Analogie oder Regel? Sprachregeln sind metasprachlich. Das Material muß begrifflich erfaßt, kategorisiert und benannt werden. Die Formulierung einer Regel ist wie jedes Sprechen eine gesellschaftliche Tätigkeit; das gilt erst recht vom Schlußfolgern. Albert Wellek lehnte daher diese Intellektualisierung des analogischen Verhaltens ab und wies auch Helmholtz’ These vom unbewußten Schließen als widersprüchlich zurück (Witz, Lyrik, Sprache. Bern 1970:194ff.). Den Erlebnisaspekt versuchte Wellek mit dem Begriff des „Analogie-Gefälles“ zu erfassen. Die Analogie schließt an konkrete Muster an und besteht darin, in gewisser Hinsicht das gleiche zu tun. Übernimmt ein Verb die Rektion eines anderen, sieht der Sprecher über ihren Unterschied hinweg und behandelt sie gleich. Die Vorlage und das neue Material verhalten sich zueinander wie jede andere Verallgemeinerung. Wer Treppen steigen kann, kann auch auf Leitern steigen, obwohl die Umstände nicht genau gleich sind, weshalb zum Beispiel die Hände zu Hilfe genommen werden sollten. Wer lateinisch honor statt honos sagte, setzte das Element hono- in der gleichen Weise fort wie bisher schon in den obliquen Kasus honorem usw.; er brauchte den Rhotazismus nicht als Regel zu fomulieren wie ein Lateinlehrer. Wer trotz mit dem Genitiv statt des zuvor üblichen Dativs gebraucht, tut das gleiche, was er bisher in gleicher Umgebung mit wegen getan hat (das Ganze findet bekanntlich auch umgekehrt statt – ein Dauerbrenner der Sprachpflege). Die Antonyme introvertiert und extravertiert kommen im gleichen Kontext vor; introvertiert ist älter und häufiger als die Gegensatzbildung, und der Stamm- oder Bindevokal o ist in Komposita viel geläufiger. Unter diesem Druck ist extrovertiert heute die bevorzugte Form geworden; kein humanistisch belehrter Einwand kommt dagegen an. Das Analogie-Gefälle oder einen gewissen Sog zur neuen Form hin kann die Häufigkeit der musterbildenden Formen bewirken oder die Trägheit, die zur Regularisierung der Paradigmen führt. Das kleine Kind, das noch nicht über jene Routine des Erwachsenen verfügt, die auch sehr unregelmäßige Paradigmen gerade im Kern der Sprache am Leben hält (z. B. die starken Verben, die Präteritopräsentien oder bin/bist/ist/sind/seid), erleichtert sich das Sprechen durch gepfeift, gelügt, ich kanne usw. Die Vereinfachung ist objektiv meßbar und bestimmt auch die Richtung des Sprachwandels. Die starke Konjugation wird durch die schwache, mit Recht „regelmäßig“ genannte und häufigere ersetzt, fast nie umgekehrt. (Daß immer wieder neue Unregelmäßigkeiten entstehen, steht auf einem anderen Blatt.) Es ist überflüssig und irreführend, Reiz- und Reaktionsgeneralisierungen als Regelanwendungen zu simulieren. Jean Berko wollte in einem bekannten Versuch zeigen, daß Kinder zu einem künstlichen Substantiv wug den Plural wugs bilden (The child’s learning of English morphology. Word 14/1958:150-177). Das sollte die spontane Bildung von Regeln beim Spracherwerb beweisen. Es ist der klassische Fall von Analogie. (Sowohl die Validität von Berkos Experiment also auch ihre Deutung der Ergebnisse sind seither vielfach in Zweifel gezogen worden. Die große Verbreitung ihrer Thesen ist wohl nur aus dem Zeitgeist jener Jahre zu verstehen, als die Begeisterung für Chomskys vermeintliche Widerlegung des Behaviorismus am größten war.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.11.2024 um 05.38 Uhr |
|
Wenn man dem Gehirn bzw. dem Geist zuschreibt, im Gedächtnis zu „suchen“, Elemente „auszuwählen“ usw., erklärt man Handlungen durch Handlungen, die ebenso erklärungsbedürftig sind, aber wegen ihrer Nichtbeobachtbarkeit und spekulativen Existenz schwerer zu erklären sind als die sichtbaren Vorgänge, die sie erklären sollen. Dieser Vorwurf eines nutzlosen infiniten Regresses bzw. Zirkels ist der naturalistische Haupteinwand gegen den Mentalismus und Kognitivismus. „Im Gehirn ist die Welt dargestellt. Nicht nur als eine Sammlung von Landkarten, auf denen man sich bewegt, nicht nur als ein Katalog von Menschen, mit denen man umgeht, und auch nicht nur als eine Rumpelkammer von Begriffen und Gegenständen, mit denen man im Leben zu rechnen hat. Eher schon als ein Theater, in dem die Welt gespielt wird. Die Akteure stehen für die Gegenstände, Lebewesen und Begriffe, zwischen denen sich das Drama des Lebens abspielt. Sie benehmen sich auf der Bühne des Gehirns möglichst wie die Originale in der Außenwelt, die sie darstellen. So kann das Gehirn sozusagen mit einem „Blick nach innen“ feststellen, was in der Welt passiert, und kann darauf reagieren, ehe es zu spät ist.“ (Valentin Braitenberg: Das Bild der Welt im Kopf: Eine Naturgeschichte des Geistes. Stuttgart 2009:147) Wer führt die Puppen auf der inneren Theaterbühne, wer ist das Publikum? Braitenberg antwortet: Das sind Zellverbände (cell assemblies). Sie „repräsentieren“ die Welt. Aber das funktioniert nicht, und zwar schon aus begrifflichen Gründen. Braitenberg kann auch in den 10.000 Stunden, die er nach eigenen Angaben am Mikroskop verbracht hat, nichts dergleichen gesehen haben. Natürlich weiß er, daß es sich um eine Metapher handelt, aber in der Diktion der Neurologie kann sie nicht aufgelöst werden. Sie ist auch überflüssig, weil die Steuerung von Muskelbewegungen usw. durch das Nervensystem sich rein physiologisch erklären läßt, natürlich unter Einbeziehung der Konditionierungsgeschichte. Dazu muß die Welt nicht im Gehirn abgebildet sein. Die Maus ist nicht im Gehirn der Schlange abgebildet, und wenn sie es wäre, könnte sie das Jagdverhalten der Schlange nicht erklären. (Braitenberg ist ein zufällig ausgewähltes Beispiel. Fast alle reden heute so, es ist die kognitivistische Mode. Die wirkliche Forschung hat damit nichts zu tun.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.11.2024 um 05.09 Uhr |
|
„Knackpunkt der Imitation ist die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen – eine mentale Repräsentation von dem zu haben, was sich im Kopf des Gegenübers abspielt. Denn zur echten Nach-Ahmung gehört, daß ich mir darüber klar bin, was mein Gegenüber will, daß ich in gewissem Sinn ‚Gedankenlesen‘ betreibe. Imitation setzt damit das voraus, was im Englischen ‚theory of mind‘ heißt.“ (Volker Sommer: „Geistlose Affen oder äffische Geisteswesen? Eine Exkursion durch die mentale Welt unserer Mitprimaten“. In Alexander Becker u. a., Hg.: Gene, Meme und Gehirne. Geist und Gesellschaft als Natur. Frankfurt 2003:112-136, S. 130f.) Es fällt auf, daß Hineinversetzen, mentale Repräsentation, Gedankenlesen und Theorie des Geistes gleichgesetzt werden. Alles zusammen läuft auf die herkömmliche „Vorstellung“ hinaus. Dagegen ist u. a. zu sagen, daß Repräsentation für viele Autoren eine bewußtseinsfremde Spur sein kann, die das Lernen bzw. die Anpassung im Gehirn hinterläßt (vgl. etwa Braitenberg einerseits, die Ethologie andererseits). Aber es wäre vergeblich, diese Begriffsverwirrung aufllösen zu wollen. Man muß von vorn anfangen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.12.2024 um 05.00 Uhr |
|
Die Annahme von „Belohnungszentren“ im Gehirn übernimmt, ohne es ausdrücklich zu sagen, die behavioristische Theorie der Konditionierung durch „Verstärkung“. Der Wikipedia-Eintrag zum Nucleus accumbens zeigt es: „Das mesolimbische System fördert durch Glücksgefühle das Verstärken bestimmter Verhaltensmuster, die mit Belohnung in Verbindung stehen.“ Damit erbt die Darstellung die bekannte Crux des Behaviorismus: Es ist begrifflich schwierig, von „Selbstverstärkung“ zu sprechen. Zweitens: Skinner würde bestreiten, daß man die „Gefühle“ als kausalen Faktor einschalten muß. Die Rede von Belohnung, Glück usw. paßt nicht zur hirnphysiologischen Begrifflichkeit. Man lernt am Erfolg, ob mit oder ohne Gefühle. Ich beobachte die Enkelin, wie sie im Hantieren mit Legosteinen immer geschickter wird. Sie lernt am Erfolg, aber soll man ihr alle paar Sekunden ein Glücksgefühl unterstellen, weil die Belohnungstheorie es fordert? Das läuft auf eine Tautologie oder einen Zirkel hinaus und erklärt nichts. Eine belohnende Instanz innerhalb des Gehirns läuft auf ein Homunkulusmodell hinaus. Die Bahnung von künftigem Verhalten durch erfolgreiches jetziges sollte anders erklärt werden. |