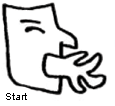


| Diskussionsforum | Archiv | Bücher & Aufsätze | Verschiedenes | Impressum |
Theodor Icklers Sprachtagebuch
06.02.2011
Bedeutendst
Wie man das Maul aufreißt, aber dann doch nichts sagt
Johannes Paul II. ist vielleicht die bedeutendste Persönlichkeit des 20. Jahrhunderts. (Daniel Deckers, FAZ 14.1.11)
Ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht ...
Diese Verbindung von gewaltigstem Anspruch und kleinmütiger Rückversicherung ist sehr beliebt:
Heiner Müller und Botho Strauß, vielleicht die wichtigsten Dramatiker der vergangenen beiden Jahrzehnte ... (Mitt. d. Dt. Germanistenverbandes 3/2001)
Reinhard Baumgart, der vielleicht eleganteste Literaturkritiker der Bundesrepublik Deutschland ... (FAZ 12.8.06)
Vielleicht ist es sein schönstes Buch. (Marcel Reich-Ranicki über Siegfried Lenz' „Schweigeminute“, Verlagsanzeige 2008)
Derek Walcott, der wohl bedeutendste lebende Dichter der westlichen Hemisphäre ... (Thomas Poiss in Forum Classicum 2002:252)
Ein fränkischer Schriftsteller schreibt gar dies:
Der 1966 geborene Lyriker hat die vielleicht zwei am meisten bedeutungsschwangeren Zeilen beigesteuert. (Nürnberger Nachrichten 6.12.03)
| Kommentare zu »Bedeutendst« |
| Kommentar schreiben | älteste Kommentare zuoberst anzeigen | nach oben |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.12.2023 um 19.13 Uhr |
|
Ich habe das Interview der SZ mit der Einsamkeitsforscherin Maike Luhmann nicht gelesen, nur den letzten Satz: „Wenn man wirklich etwas verändern will, muß man auch Geld in die Hand nehmen.“ Das hatte ich schon erwartet, und darum habe ich den letzten Satz auch lesen wollen. |
Kommentar von Wolfram Metz, verfaßt am 26.12.2023 um 11.13 Uhr |
|
»Folgen auf die Gesundheit«, so steht es tatsächlich im Namen der Kommission. Vielleicht war ursprünglich an »Auswirkungen« gedacht und irgendwer hat das Wort dann ausgetauscht. Auch »Gesundheit des Landtags NRW« erscheint mir etwas unglücklich, das könnte man durch eine Umstellung leicht vermeiden.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.12.2023 um 04.50 Uhr |
|
„Seit Frühling 2020 ist Prof. Luhmann ständige Sachverständige in der Enquete-Kommission ‚Einsamkeit‘ - Bekämpfung sozialer Isolation in Nordrhein-Westfalen und der daraus resultierenden physischen und psychischen Folgen auf die Gesundheit des Landtags NRW.“ Das steht unter Luhmanns Bericht, in dem sie ausdrücklich feststellt, Einsamkeit sei nicht mit sozialer Isolation zu verwechseln. Sie reist also eigentlich auf dem falschen Dampfer. Die „Positive Psychologie“, die sie vertritt, steht zwischen Wissenschaft und Beratung und bedient sich der „wohltuenden“ Begrifflichkeit einer Wald-und-Wiesen-Psychologie, die sich problemlos ins Feuilleton übernehmen läßt. Wenn Einsamkeit als ein Gefühl bestimmt wird, dürfte es für die Politik nicht leicht sein, sie zu bekämpfen. Es wäre auch nicht ihre Aufgabe. Bei sozialer Isolation sieht es anders aus, man denke an Städteplanung usw. |
Kommentar von Wolfram Metz, verfaßt am 26.12.2023 um 01.40 Uhr |
|
Die Bochumer Professorin Maike Luhmann ist Deutschlands bekannteste Einsamkeitsforscherin. (sueddeutsche.de, 22.12.23) Wie viele Einsamkeitsforscher kennen Sie? Frau Luhmann ganz bestimmt. |
Kommentar von Wolfram Metz, verfaßt am 11.10.2020 um 14.54 Uhr |
|
Einige Zeitungen erwähnen es kurz, z. B. Die Presse, die SZ und Der Tagesspiegel: https://www.diepresse.com/5878471/autorin-und-germanistin-ruth-kluger-gestorben https://www.sueddeutsche.de/kultur/ruth-klueger-nachruf-gestorben-1.5057433 https://www.tagesspiegel.de/kultur/nachruf-auf-ruth-klueger-unbestechliche-gegen-rednerin/26253972.html |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.10.2020 um 04.42 Uhr |
|
In den Nachrufen auf Ruth Klüger wird ihr "Frauen lesen anders" nicht erwähnt (soweit mir bekannt). Der Text scheint nicht nur mich befremdet zu haben.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.05.2020 um 05.56 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1409#24938 ff. Um Reich-Ranicki zu ehren, druckt die FAZ in ihrer Anthologie schon wieder den alten Text über Goethes "Rezensent" ab. "Kontraproduktiv", wie man heute sagt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.02.2020 um 05.47 Uhr |
|
Frank Schirrmachers Biographie ist vielleicht die letzte, die man exemplarisch nennen muss: Michael Angele hat das erste Porträt des großen Journalisten, Herausgebers der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Bestsellerautors geschrieben. (Verlagsankündigung) Gemeint ist aber nicht die Biographie, sondern das Leben Schirrmachers. Und was soll daran exemplarisch genannt werden müssen? Na ja, „vielleicht“... Angele schreibt auch keine Biographie, sondern eben ein „Portrait“, was immer das sein mag. Viel Neues erfährt man nicht. Daß Wolfgang Bergsdorf, der wiederum Kohl nahe stand, einer der Förderer war, denen Schirrmacher seinen Aufstieg zum Literaturchef der FAZ verdankte, könnte für das Einknicken bei der Rechtschreibreform bedeutsam gewesen sein. Wie auch immer, der beklagenswerte orthographische Zustand der FAZ (und das Schweigen darüber) ist den heutigen Herausgebern anzulasten. |
Kommentar von Theodor Icker, verfaßt am 04.02.2017 um 03.58 Uhr |
|
Ich bin der Sache nicht nachgegangen, aber das Argument mit der Fuge im Kompositum gilt nicht, man denke an Grasmücke.
|
Kommentar von M Martin, verfaßt am 03.02.2017 um 12.56 Uhr |
|
Damit das Heidenröslein die Heidruose los wird, bitte folgendes beachten: Die Verbindung Heidruose zu Heidenröslein ist sehr gewagt und nicht nachweisbar. In "Die Frühgeschichte der mittelalterlichen medizinischen Fachsprache ...", Band 1 von Jörg Rieke wird die Wortherkunft und -umbildung ab Seite 106 dargestellt. Eigentlich meint Hegedrüse das Wort hegidrous(a) oder hegidruosi oder eben heidruose, wobei zuletzt offenbar hegi zu hei- verkürzt wurde. Dabei kommt dem Wort hegen im Sinne von Beinhalten die stärkere Bedeutung zu. Eine Beziehung zu Heide oder Heiden-röslein wäre ebenso falsch sinnfällig wie eine Beziehung zu Heiden als Ungläubige im christlichen Sinne. Also Vorsicht mit Sprachethymologie, nur weil ein oder zwei Buchstaben übereinstimmen. Denn das Wort zerfällt in hegi- (hegen) und -druosa (Drüse). Damit klappt aber die Herleitung hegi zu Heid zu Heiden nicht, denn das d gehört zu druosa (Drüse) und es kann dann nicht ruosa als Rose oder Röslein sein. Denn es heißt hei- und -druose. Also kann hei nicht hegi und damit nicht hegidrüse sein. Es ist einfach das Röslein auf der Heiden sonst nix. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.10.2016 um 05.12 Uhr |
|
Zur Verbesserung des Stils sollte man die Hälfte der Adjektive und neun Zehntel der Verstärkungsmittelchen streichen. Dazu gehört besagter Superlativ. Er liest verschiedenste Zeitungen > Er liest verschiedene Zeitungen > Er liest Zeitungen. Der Plural drückt aus, daß es mehrere sind, und verschieden werden sie ja wohl auch sein, denn niemand liest mehrere Ausgaben derselben Zeitung, um blondinenmäßig festzustellen, ob sie auch die Wahrheit sagt. Gegen diese Stilregel habe ich selbst oft verstoßen, auch in diesem Tagebuch. |
Kommentar von Erich Virch, verfaßt am 13.10.2014 um 23.03 Uhr |
|
Wäre interessant zu wissen, wie die Heidruose zu ihrem „n“ im Heidenröslein gekommen sein sollte, aber davon abgesehen – sah ein Knab seine Hoden stehn, dachte an Kastration und brach sie?
|
Kommentar von R. M., verfaßt am 13.10.2014 um 20.48 Uhr |
|
Selbst wenn diese etymologischen Zusammenhänge bestehen sollten, spricht rein gar nichts dafür, daß sie, wie der anonyme Schlaumeier unterstellt, dem 21jährigen Göthe bewußt waren. Er hat selbst rückblickend zugegeben, daß er keine Lust gehabt habe, das Mittelhochdeutsch der Minnesänger zu studieren.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.10.2014 um 16.46 Uhr |
|
Um noch einmal auf Goethes "Heidenröslein" zurückzukommen: Zufällig stoße ich auf einen Ergänzung bei Wikipedia, die mir unbekannt war und von der ich auch nicht weiß, ob sie relevant ist: "Die sexuelle Metaphorik des Liedes ist bereits in seinem Titel angelegt, der zur Entstehungszeit der Vorlage im 16. Jahrhundert einen Doppelsinn hatte, den Goethe noch herausgehört haben dürfte, auch wenn er modernen Sprechern der deutschen Sprache nicht mehr offensichtlich ist. Das "Heidenröslein" ist nämlich eine frühneuhochdeutsche Umformung des mittelhochdeutschen Wortes "Heidruose", wie es zum Beispiel bei Wolfram von Eschenbach auftaucht. "Heidruose“ aber hat weder mit Heide noch mit Rose zu tun, sondern heißt soviel wie Hegedrüse, sprich Hoden. Der vergiftete Speer, der König Anfortas im Roman Parzival die "Heidruose" verletzt, entmannt ihn, nimmt ihm die Zeugungskraft. Goethe spielt mit diesem Doppelsinn zugleich auch auf die vom Mittelalter bis zu seiner Zeit gebräuchliche Strafe für Vergewaltigung an, nämlich die Kastration. Insofern legt bereits der Titel eine Interpretation des Geschehens als Vergewaltigung nahe, auch wenn die harmlosere Lesart als freiwilliges Schäferstündchen nicht ausdrücklich ausgeschlossen wird." Offen bleibt aber auch hier, was es mit dem Stechen und der beim "Knaben" zurückbleibenden Wunde auf sich hat. Anscheinend tragen doch beide ihre Blessuren davon? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.02.2014 um 08.06 Uhr |
|
Bei jenem größten Dichter der westlichen "Hemisphäre" stört mich auch der Wechsel ins astronomische Fach, denn aus dessen Begriffssystem stammt ja die Betrachtung der Erde als Kugel. Wir sprechen von der "Erde" oder auch von der "Welt" (die aus anthropozentrischer Sicht so benannt ist und sich erst später zum Ganzen, zum Weltall ausgeweitet hat). Wenn jemand Shakespeare oder Goethe oder sonstwen für den größten Dichter hält, beschränkt er sich wie selbstverständlich auf die westliche Welt; auf der anderen Seite der Erde wird gar nicht erst gesucht. So weit, so verständlich. Neuerdings verbreitet sich in gewissen Kreisen auf dem Planeten, womit zwar ebenfalls unser "Heimatplanet" gemeint ist, aber eben wiederum aus astronomischer Sicht. Gestern kam in den Medien, daß eine Schlagersängerin eine andere die heißeste Frau auf dem Planeten genannt hat. Selbst wenn heiß unter amerikanischem Einfluß seine Bedeutung ein wenig geändert hat, klingt das marktschreierisch. Da rasen die Galaxien, da ist das Sonnensystem, da der winzige Erdball - und mitten drauf eine Rihanna oder Shakira. Es paßt zum Ton des heutigen Showbusiness, aber man kann es auch schon in seriöseren Texten lesen. Mit dieser Mode müssen wir jetzt eine Zeitlang leben. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.01.2014 um 05.24 Uhr |
|
Was Klüger zu Huckleberry Finn schreibt, möchte ich doch noch ausführlicher zitieren (der Aufsatz ist ungekürzt an verschiedenen Stellen erschienen): Ralph Ellison, der berühmte, jüngst verstorbene amerikanische schwarze Autor des Romans „Invisible Man“ schrieb einmal, er habe als Junge Mark Twains Roman „Die Abenteuer des Huckleberry Finn“ selbstverständlich vom Standpunkt des weißen Ich-Erzählers Huck und nicht etwa vom Standpunkt des entlaufenen Sklaven Nigger Jim rezipiert. Denn dieser ist eine reduzierte, etwas schlotternde Nebengestalt, von der man sich nicht inspirieren lassen kann, und jener, der Weiße, ist der Held und Abenteurer. Ist das überhaupt erwähnenswert? Natürlich "rezipiert" (= liest) man eine Ich-Erzählung vom Standpunkt des Erzählers, und selbst wenn es keine Ich-Erzählung ist, legt der Verfasser den Standpunkt fest. Ich habe eine Reihe Autobiographien von schwarzen Sklaven aus den USA und lese sie selbstverständlich vom Standpunkt der weiblichen und männlichen Verfasser und nicht vom Standpunkt der weißen Herren. |
Kommentar von Argonaftis, verfaßt am 29.01.2014 um 10.50 Uhr |
|
Man google mal nach "Heidenröslein Ulrike Lemke". Rainer Brüderle und Laura Himmelreich sind uns noch gut im Gedächtnis. Immerhin lebt der noch und konnte die Sache ausstehen; Goethe ist schon tot, aber "leider" verläßt (noch) niemand den Saal, wenn das Heidenröslein angestimmt wird. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.01.2014 um 08.11 Uhr |
|
Zum "Heidenröslein" gibt es auch einen irritierend einseitigen Kommentar von Ruth Klüger: Die Verherrlichung oder Verharmlosung der Gewalt gegen Frauen in der Literatur beginnt früh, zum Beispiel mit dem „Heideröslein“. Man sollte meinen, daß sich die symbolische Darstellung einer brutalen Vergewaltigung, vertont oder unvertont, nicht zum Schulunterricht eigne und schon gar nicht auf eine Stufe mit wirklichen Liebesliedern gesetzt werden solle. Denn Goethe hin, Schubert her, die letzte Strophe ist eine nur leicht verbrämte Terrorszene: „Doch der wilde Knabe brach / ’s Röslein auf der Heiden. / Röslein wehrte sich und stach / Half ihm doch kein Weh und Ach / Mußt’ es eben leiden.“ Die Verharmlosung entsteht dadurch, daß der Vergewaltiger, also ein ausgewachsener, zumindest geschlechtsreifer Mann, als „wilder Knabe“ einherkommt, daß die Tat symbolisch an einer Blume ausgeführt wird, obwohl deutlich Kraftmeier und schwächeres Mädchen gemeint sind, und daß im hingeträllerten Refrain „Röslein, Röslein, Röslein rot / Röslein auf der Heiden“ der Terror verplätschert. Das Lied ist verlogen, weil es ein Verbrechen als unvermeidlich und obendrein wie eine Liebesszene darstellt. Heike Sander hat in ihrem umstrittenen Dokumentarfilm „(Be)Freier und Befreite“ einen Männerchor eingesetzt, der das „Heideröslein“, kommentarlos und unmißverständlich, im Kontext der Massenvergewaltigungen des Zweiten Weltkriegs singt. Damit ein Mädchen oder eine Frau ein solches Lied hübsch findet, muß sie mehr von ihrem menschlichen Selbstbewußtsein verdrängen, als sich lohnt, von ihren erotischen Bedürfnissen ganz zu schweigen. (Ruth Klüger: Frauen lesen anders. ZEIT 25.11.94) Vgl. dagegen http://de.wikipedia.org/wiki/Heidenr%C3%B6slein Irriitierend finde ich aber schon die Verallgemeinerung "Frauen lesen anders". Alle Frauen? Hat man je daran gedacht, daß z. B. Atheisten auch anders lesen und Bildwerke anders sehen könnten? Klüger erwähnt den Raub der Sabinerinnen und ähnliches, wobei es ihr aber nur auf Gewalt gegen Frauen ankommt. Sie habe als Zehnjährige Anstoß genommen an Schillers Ode an die Freude (Alle Menschen werden Brüder und sollten ein holdes Weib erringen usw.). Was fangen Schwarze mit Huckleberry Finn an, aus der Sicht des weißen Jungen, nicht des Niggers Jim erzählt? (Ebd.) Fragen über Fragen. |
Kommentar von Karl Hainbuch, verfaßt am 28.01.2014 um 22.20 Uhr |
|
Ist nicht das Heideröslein feinster Humor? Auf den der Ranicki reingefallen ist, als er es ein Gedicht über eine Vergewaltigung genannt hat? Immerhin: sie will, daß er ewig an sie denkt. http://www.youtube.com/watch?v=_LlAx8T8CxU |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.01.2014 um 07.16 Uhr |
|
Humor ist ja auch nicht ohne Einschränkung etwas Gutes, Humorlosigkeit also auch nicht unbedingt ein Mangel. Ich vermisse ihn, wo er das Pathos dämpfen könnte. Aber ich habe auch immer wieder Leute kennengelernt, deren Humor mir mächtig auf die Nerven ging. Die Dosis macht's. Wilhelm Busch, der das Leben nicht gerade freundlich anblickte, hat viele Verse geschrieben, deren ich niemals überdrüssig werde. Aber sogar im bescheidenen "Struwwelpeter" hat Hoffmann wunderbare Zeilen erfunden. Gerade gestern zum Beispiel haben wir im Familienkreis wieder mal über Mohren (und -apotheken) gesprochen, und mir fiel ein: "Die Sonne schien ihm aufs Gehirn." Auf so etwas muß man erst einmal kommen! Echte Weltliteratur. |
Kommentar von Urs Bärlein, verfaßt am 27.01.2014 um 23.55 Uhr |
|
Komisch ist ja schon die Entlarvung Goethes als Anhänger der Todesstrafe. Als Strafe kann diese nur Ergebnis eines mehr oder weniger förmlichen Verfahrens sein, nicht der bloßen Aufforderung, jemanden totzuschlagen. Man muß Reich-Ranicki als Unterhaltungskünstler sehen. Seine Kunst war, andere in Szene zu setzen (und natürlich sich selbst). Irgendwann hat er gemerkt, daß ihm das Publikum seine Auftritte tatsächlich als Literaturkritik abnahm. So eine Erfahrung reizt dazu auszuprobieren, wie weit man gehen kann. Deshalb tippe ich auf freiwillig.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 27.01.2014 um 22.40 Uhr |
|
Da tippe ich auf unfreiwillig. MRR fühlte sich offenbar angesprochen und war beleidigt, ich kann mir nicht vorstellen, daß er in seiner Erwiderung absichtlich komisch sein wollte. Das wäre auch eine Art Humor gewesen. An dem es ihm allerdings sonst nicht mangelte. Danke, lieber Herr Höher. So ausführlich, und wie immer mit einer Menge interessanter Gedanken und Fakten. Was ich mir unter dichterischem Humor vorstelle, findet man etwa bei Wilhelm Busch oder Christian Morgenstern, die natürlich auch gleich dessen ganze Verschiedenheit aufzeigen. Die Goethesche "Frohnatur" ist halt wieder etwas anderes, aber ich möchte ihm auch den Humor nicht ganz absprechen. Übrigens, ist es nicht paradox? Wenn man direkt nach Dichtername plus "Humor" sucht, findet man kaum Humorvolles, sondern vor allem ernste Sprüche über Humor. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 26.01.2014 um 22.15 Uhr |
|
»Indem Goethe seine Leser auffordert, die Rezensenten totzuschlagen, entpuppt er sich als Anhänger der Todesstrafe und als ein Gegner der Meinungsfreiheit; überdies ist auch der Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt.« Das mit der Volksverhetzung ist schon komisch – fragt sich nur, ob unfreiwillig oder nicht.
|
Kommentar von Oliver Höher, verfaßt am 26.01.2014 um 12.43 Uhr |
|
Lieber Herr Riemer, egal, ob dies nun ein „Glanzstück von Goethe“ ist, er hat das Gedicht in seine dritte rechtmäßige Werkausgabe aufgenommen. Vor allem den Gedichten und der Gedichtanordnung in der zweiten Cotta-Ausgabe (Sigle B) kommt große Bedeutung zu. Anders als bei der „Ausgabe letzter Hand“, also der dritten Cotta-Ausgabe (Sigle C), hat Goethe in der Ausgabe B die Anordnung und die Auswahl der Gedichte selbst besorgt. Natürlich ist nicht alles, was im Laufe von mehr als 50 Jahren entstanden ist, große Lyrik. Aber in den Jahren von 1814 bis 1815 entstanden immerhin auch die meisten Divan-Gedichte. Sie fragen nach etwas von Goethe, „das man als guten Humor gelten lassen kann“. Was verstehen Sie denn unter gutem Humor? Immerhin zitieren Sie damit fast einen Aufsatz von Walter Brednow (Vom „guten Humor“ zum „reinen Humor“ bei Goethe, in: Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts, Jg. 1977, S. 111–128). Das Standardwerk zu dem Thema ist übrigens immer noch die Berner Dissertation von Georg Küffer (Goethe und der Humor, Bern: Horat 1933). Die wichtigsten Äußerungen Goethes zum Humor finden Sie dort zusammengestellt. Aber dennoch ist die Ausbeute beider Veröffentlichungen eher mager und enttäuschend. Für Spott, Parodie, Satire und Possen gibt es vor allem beim jungen Goethe genügend Beispiele. Für Ironie ebenfalls, vor allem Mephisto ist im ersten Teil des „Faust“ herrlich ironisch. Aber Humor? Womöglich steht Goethe da seine eigene Überlegung im Weg, die er beispielsweise in einem Brief an Schiller vom 31.1.1798 äußert. Es geht um die Aufführung von Domenico Cimarosas Opera buffa „Il marito disperato“, die am 30.1.1798 als „Die bestrafte Eifersucht“ im Weimarer Theater aufgeführt wurde: Gestern haben wir eine neue Oper gehört, Cimarosa zeigt sich in dieser Komposition als einen vollendeten Meister, der Text ist nach Italienischer Manier, und ich habe dabei die Bemerkung gemacht: wie es möglich wird, daß das Alberne, ja das Absurde sich mit der höchsten ästhetischen Herrlichkeit dieser Musik so glücklich verbindet. Es geschieht dies allein durch den [gesperrt:] Humor, denn dieser, selbst ohne poetisch zu sein, ist eine Art von Poesie und erhebt uns seiner Natur nach über den Gegenstand. Dafür hat der Deutsche so selten Sinn, weil ihn seine Philisterhaftigkeit jede Albernheit nur ästimieren läßt, die einen Schein von Empfindung oder Menschenverstand vor sich trägt. [Text nach: Der Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, nach den Handschriften des Goethe- und Schiller-Archivs herausgegeben von Hans Gerhard Gräf und Albert Leitzmann, 3 Bände, Leipzig: Insel-Verlag 1955, Bd. 2: 1798–1805, S. 32.] Jean Paul wird gemeinhin als humoristischer Schriftsteller bezeichnet. Richter hat bekanntlich Goethe seine beiden Romane „Die unsichtbare Loge“ (1793) und „Hesperus“ (1795) geschickt. Darauf reagiert hat Goethe freilich nicht. Aber gelesen hat er zumindest den „Hesperus“, da er sich vom 10. bis 18.6.1795 mit Schiller über diesen Roman auseinandersetzt. Für Schiller ist der Roman immerhin noch Unterhaltungsware, wie er am 12.6.1795 an Goethe schreibt: Das ist ein prächtiger Patron, der Hesperus, den Sie mir neulich schickten. Er gehört ganz zum Tragelaphen-Geschlecht, ist aber dabei gar nicht ohne Imagination und Laune und hat manchmal einen recht tollen Einfall, so daß er eine lustige Lekture für die langen Nächte ist. [ebd., Bd. 1, S. 75] Insgesamt war Goethes Verhältnis zum Humor nicht gerade gut. Da mag Jean Paul mit seinem Erfolg noch irritierend hinzugetreten sein. Herr Ickler hat inzwischen den Witz erwähnt. Aber ebenso wie der Begriff des Humors unscharf ist, verstehen wir auch heute unter Witz etwas anderes als frühere Jahrhunderte. Goethe war die Humoralpathologie durch die Lektüre der alten Volksbücher, der Fastnachtsspiele, des Faustbuchs und der Werke von Hans Sachs nicht fremd. In seinen Briefen führt er Stimmungen immer wieder gerne auf körperliche Befindlichkeiten zurück. Auch Schillers medizinische Dissertation (1780!) ist übrigens noch ganz der Säftetheorie verpflichtet. Und Witz war schließlich im 18. Jahrhundert ein anderes Wort für Geist. Ein witziger Einfall war ganz einfach ein geistreicher Einfall. Freilich kultivierte man zu dieser Zeit auch kürzere Versstücke, die heute noch als Witze durchgehen könnten. Wichtig daran war aber vor allem der Einfall und die geistreiche Pointe. Hier ist – und damit mache ich nun wirklich Schluß – ein Beispiel von Lessing (aus den „Fabeln und Erzählungen“ von 1771): Faustin Faustin, der ganze funfzehn Jahr Entfernt von Haus und Hof und Weib und Kindern war, Ward, von dem Wucher reich gemacht, Auf seinem Schiffe heimgebracht. »Gott, seufzt der redliche Faustin, Als ihm die Vaterstadt in dunkler Fern erschien, Gott, strafe mich nicht meiner Sünden, Und gib mir nicht verdienten Lohn! Laß, weil du gnädig bist, mich Tochter, Weib und Sohn Gesund und fröhlich wieder finden.« So seufzt Faustin, und Gott erhört den Sünder. Er kam, und fand sein Haus in Überfluß und Ruh. Er fand sein Weib und seine beiden Kinder, Und - Segen Gottes! – zwei dazu. Quelle: http://www.zeno.org/Literatur/M/Lessing,+Gotthold+Ephraim/Fabeln/Fabeln+und+Erz%C3%A4hlungen+%28Ausgabe+1771%29/7.+Faustin?hl=faustin |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.01.2014 um 03.51 Uhr |
|
Herzlichen Dank an Herrn Höher für die umfassende Dokumentation! Und ich will wirklich nicht die Gelegenheitsgedichte Goethes zu größten Kunstwerken emporjubeln. Ich hatte mich nur über das so offensichtlich Verfehlte der Interpretation gewundert Humor? Darauf will ich auch nicht bestehen, weil ich weiß, wie unscharf und wandelbar der Begriff ist. Aus der Antike gibt es Witze, die uns eher befremden als amüsieren. Wenn man nicht zum selben System von Normen gehört, kann man auch deren spielerische Durchbrechung nicht genießen. Beim Lesen der Tageszeitung kommt mir immer wieder das Lied vom Floh in den Sinn. Gut gemacht! Auch Fausts Famulus ist unsterblich. |
Kommentar von Urs Bärlein, verfaßt am 26.01.2014 um 02.33 Uhr |
|
Marcel Reich-Ranicki war ein genialer Clown, und als solcher hat er seine Verdienste – sogar um die Literatur. Auf eine Tirade über das "Literarische Quartett" entgegnete mir meine Mutter: "Aber es ist doch lustig!" Da hatte sie recht. Mehr darf man freilich nicht von jemandem erwarten, für den ein Grass, ein Böll oder ein Martin Walser die Maßstäbe setzen, nach denen Literatur zu bewerten ist. An Ernst Jünger hat er sich nie herangetraut.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 25.01.2014 um 22.36 Uhr |
|
Goethe als Anhänger der Todesstrafe und Gegner der Meinungsfreiheit - das ist im gleichen Sinne vielleicht auch die dümmste Rezension von MRR. Was ich aber nicht bestreiten möchte, ich halte dieses Gedicht auch nicht gerade für ein Glanzstück von Goethe. Aber er konnte sich so einen Ausrutscher leisten. Hat MRR hiermit nicht völlig recht: ... der Rezensent, der sich der Arbeiten eines Schriftstellers annimmt, ist nicht von diesem hierzu ausgewählt und eingeladen worden und wird nicht von ihm bewirtet. Im Gegenteil: Er ist gehalten, das, was der Autor geleistet hat, zu prüfen und zu beurteilen und seine Meinung möglichst klar darzulegen, und zwar ohne sich darum zu kümmern, ob dies dem Betroffenen gefallen werde oder nicht. Das ist doch Reich-Ranickis Grundaussage. Etwas humorlos wohl, aber Goethes Humor scheint mir in diesem Gedicht eben auch (mit MRR's Worten) hinten und vorne nicht zu stimmen. Vielleicht eine Frage an Herrn Höher: Gibt es von Goethe eigentlich auch etwas Humorvolles, etwas, das man als guten Humor gelten lassen kann? Ich schätze Goethe natürlich sehr, aber zu Humor will mir partout nichts von ihm einfallen. |
Kommentar von Oliver Höher, verfaßt am 25.01.2014 um 21.18 Uhr |
|
Goethe wußte 1773 mit Sicherheit, „was für ein toller Kerl er war“. Darüber hinaus wußte er, was er schon veröffentlicht hatte. Der Roman „Die Leiden des jungen Werthers“ erschien erst zur Michaelismesse, also im September 1774 bei Weygand in Leipzig. Im folgenden gebe ich einen Überblick über die Publikationsgeschichte und den inzwischen sehr wahrscheinlichen Anlaß für das Gedicht. Die Abkürzung FL bezieht sich dabei auf die kritische Ausgabe der Werke des jungen Goethe, herausgegeben von Hanna Fischer-Lamberg (mit römischer Band- und arabischer Seitenzahl), WA bezeichnet die sogenannte Weimarer Ausgabe mit römischer Abteilungs- und dann jeweils arabischer Band- und Seitenzahl. FA schließlich bezeichnet die Frankfurter Ausgabe mit römischer Band- und arabischer Seitenzahl. Alle übrigen Quellen gebe ich jeweils genau an. Das Gedicht erschien zunächst anonym und ohne Titel in der Rubrik „Poetischer Winkel“ in Matthias Claudius’ Zeitschrift „Der Wandsbecker Bothe“, Jahrgang 1774 „Mittwochs, den 9ten März“, Spalte7: Da hatt ich einen Kerl zu Gast, Er war mir eben nicht zur Last, Ich hatt so mein mein gewöhnlich Essen. Hat sich der Mensch pump satt gefressen Zum Nachtisch was ich gespeichert hatt! Und kaum ist mir der Kerl so satt, Thut ihn der Teufel zum Nachbar führen, Über mein Essen zu raisonniren. Die Supp hätt können gewürzter seyn, Der Braten brauner, firner der Wein. Der tausend Sackerment! Schlagt ihn todt den Hund! Es ist ein Recensent. [Text nach FL III, 72] Danach findet sich das Gedicht unter dem Titel „Der unverschämte Gast“ im sogenannten Göttinger Musenalmanach, Musen-Almanach A[nno] MDCCLXXV, Göttingen, bey J. C. Dieterich , S. 59. Dort ist der Text mit „H.D.“ unterzeichnet: Der unverschämte Gast. Da hatt ich einen Kerl zu Gast, Er war mir eben nicht zur Last, Ich hatt so mein mein gewöhnlich Essen. Hatt sich der Kerl pump satt gefressen Zum Nachtisch was ich gespeichert hatt! Und kaum ist mir der Kerl so satt, Thut ihn der Teufel zum Nachbar führen, Über mein Essen zu raisonniren. Die Supp hätt können gewürzter seyn, Brauner der Braten, firner der Wein. Der Tausend Sackerment! Schlagt ihn todt den Hund! Es ist ein Recensent. Goethe nimmt das Gedicht zuerst 1815 in seine zweite, bei Cotta erscheinende Werkausgabe auf (Sigle B). Dort steht es in der Abteilung „Parabolisch“ im 2. Band, Seite 200: Recensent. Da hatt’ ich einen Kerl zu Gast, Er war mir eben nicht zur Last; Ich hatt’ just mein gewöhnlich Essen, Hat sich der Kerl pumpsatt gefressen, Zum Nachtisch, was ich gespeichert hatt’. Und kaum ist mir der Kerl so satt, Thut ihn der Teufel zum Nachbar führen Über mein Essen zu räsonniren: „Die Supp’ hätt’ können gewürzter sein, Der Braten brauner, firner der Wein.“ Der Tausendsakerment! Schlagt ihn todt den Hund! Es ist ein Recensent. [Text nach WA I, 2, 204; bibliographische Angaben und Lesarten ebd. S. 347] Damit steht nun die Druckgeschichte des Textes fest. Unklar ist damit noch, warum Goethe jedoch dieses Gedicht gegen einen Rezensenten überhaupt veröffentlich hat. FL schreibt in ihren Anmerkungen dazu nichts (Bd. III, S. 434). In FA I, 904 gibt Karl Eibl in seinem Kommentar zum Erstdruck des „Wandsbecker Bothen“ einen Hinweis auf Christian Heinrich Schmid und Goethes Brief an Kestner vom 25.12.1772. Brief an Johann Christian Kestner, von demselben mit einem Empfangsvermerk versehen, „Acc. Wetz. D. 26. Dec.72“, deshalb auf den 25. Dezember 1772 datiert: Der Scheiskerl in Giessen der sich um uns bekümmert wie das Mütterlein im Evangelio um den verlohrnen Groschen, und überall nach uns leuchtet und stöbert, dessen Nahme keinen Brief verunzieren müsse in dem Lottens Nahme steht und eurer. Der Kerl ärgert sich dass wir nicht nach ihm sehn, und sucht uns zu necken dass wir seyn gedencken. Er hat um meine Baukunst, geschrieben und gefragt so hastig, dass man ihm ansah das ist gefunden Fressen für seinen Zahn, hat auch flugs in die Frfurter Zeitung eine Rezension gesudelt von der man mir erzält hat. Als ein wahrer Esel frisst er die Disteln die um meinen Garten wachsen nagt an der Hecke die ihn vor solchen Tieren verzäunt und schreit denn sein Critisches J! a! ob er nicht etwa dem Herrn in seiner Laube bedeuten möchte: ich binn auch da. [FL III, 15–16] Nach FL III, 412 bezieht sich der „Scheiskerl“ auf Christian Heinrich Schmid (1746–1800), der seit 1771 Professor für Beredsamkeit und Poesie an der Universität in Gießen war. Zu Schmid vgl. auch Gero von Wilperts Eintrag in seinem „Goethe-Lexikon“ (Stuttgart: Kröner 1998, S. 950–951). Warum Eibl in seinem Kommentar den Hinweis auf Schmid abschwächt, bleibt unklar: „Vielleicht konkreter Bezug auf Christian Heinrich Schmid […]“ (FA I, 904). In Nr. 97 der „Frankfurter gelehrten Anzeigen“ erschien am 4.Dezember 1772 anonym Christian Heinrich Schmids Rezension von Goethes Aufsatz „Von Deutscher Baukunst“: https://archive.org/stream/frankfurtergele01schegoog#page/n315/mode/2up Am 10. Dezember 1772 erschien dann eine zweite Rezension Schmids im 99. Stück der „Erfurter Gelehrte Zeitungen“: Frankfurt am Mayn Ohne Anzeige des Verlegers: Von teutscher Baukunst. D. M. Eruini a Steinbach. S. 16 groß Oktav. In welcher schönen Kunst hat man uns nicht das Nationelle streitig zu machen versucht! Wir haben endlich unsre eigne Kräfte in den meisten zu fühlen angefangen, aber an die Baukunst haben wir noch wenig gedacht, da überhaupt so wenig von ihr geschrieben worden. Der Italiener beschuldigt uns darinnen des kleinen, der Franzose des gothischen Geschmacks. Beide werden hier verspottet, und wir mit gross[e]m Enthusiasmus ermuntert, eben darein unser Eigenthümliches zu setzen. Die Veranlassung dazu giebt die Betrachtung des Strasburger Münster, und die Erneuerung des Andenkens von seinem Erbauer Erwin von Steinbach. Der Patriotismus des Verfassers ist rühmlicher als seine lallende Affektation, den Genuß des Anschauens über die Spekulation zu erheben. Die kindische Bemühung, die Sprache umzukehren und zu modeln, Bildchen zusammenzutragen, biblische Anspielungen zu häufen, hat uns beynahe alles sonstige Gute verbittert. So schließt sich z. E. sein Exordium S. 4: „Also nur, vortrefflicher Mann, eh ich mein geflicktes [Zitat bis:]. . . Dir zu Ehren der Verwesung weihe.“ Wir wünschen uns doch noch erst Tacitos, ehe wir Apulejos bekommen sollen. Es ist unklar, ob Goethe sich in seinem Brief an Kestner nur auf die erste Rezension oder auch auf die zweite bezieht. Die erste in den FGA war für Goethe gewiß schmerzhafter. Beide Rezensionen Schmids beziehen sich übrigens auf den Erstdruck des Aufsatzes „Von Deutscher Baukunst“, der ohne Angabe des Verfassers, des Ortes und des Verlegers im Herbst 1772, vordatiert auf 1773 erschien. Zur Datierung des Aufsatzes vgl. FL III, 442. Der Wiederabdruck in Herders Sammlung „Von Deutscher Art und Kunst“ erschien im Mai 1773 bei Bode in Hamburg. Der einzige Zusammenhang mit Goethes „Werther“ ergibt sich übrigens aus seinem Brief an Friedrich Ernst Schönborn (von Max Morris auf die Zeit vom 1. Juni bis zum 4. Juli 1774 datiert, diese Datierung wurde 1968 von Hanna Fischer-Lamberg übernommen). In diesem Brief findet sich auch eine frühe handschriftliche Version des Gedichts: Allerhand neues hab ich gemacht. Eine Geschichte des Titels: [der Titel gesperrt] die Leiden des iungen Werthers, darinn ich einen iungen Menschen darstelle, der mit einer tiefen reinen Empfindung, und wahrer Penetration begabt, sich in schwärmerische Träume verliert, sich durch Spekulation untergräbt, biss er zuletzt durch dazutretende unglückliche Leidenschafften, besonders eine endlose Liebe zerrüttet, sich eine Kugel vor den Kopf schiesst. [FL IV, 22] Im selben Brief folgt dann auch eine Abschrift des Gedichts, um das es hier geht. Doch Goethe erklärt, daß es sich hierbei auch um ältere Texte handelt. „Die letzte Seite will ich mit Reimen besetzen. Ich habe die Zeit her verschiednes geschrieben, doch nichts ist völlig zu Stande.“ (FL IV, 25) Ein Zusammenhang mit der oben zitierten „Werther“-Stelle im Brief liegt demnach nicht vor. [Titel gesperrt] Ein Gleichniss. Da hatt ich einen Kerl zu Gast Er war mir eben nicht zur Last Ich hatt iust mein gewöhnlich Essen Hat sich der Mensch pumpsatt gefressen Zum Nachtisch was ich gespeichert hatt. Und kaum ist mir der Kerl so satt Thut ihn der Teufel zum Nachbaar führen Über mein Essen zu raisonniren Die Supp hätt können gewürzter seyn Der Braten brauner firner der Wein. Der Tausend Sakerment Schlagt ihn Todt den Hund es ist ein Rezensent. [FL IV, 26] Der Anlaß für das Gedicht vom März 1773 scheint demnach tatsächlich Goethes Erregung darüber gewesen zu sein, daß Schmid in einer oder mehreren Rezensionen im Dezember des vorigen Jahres den Baukunst-Aufsatz besprochen hat, ohne ihn wirklich verstanden zu haben. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.01.2014 um 16.24 Uhr |
|
Ein Kritiker soll gewiß auch urteilen, aber dabei nicht vergessen, daß sein Urteil kein göttliches Orakel und letzten Endes nicht so wichtig ist. Nur sehr selten (Lessing) überdauert die Kritik das kritisierte Werk. Vor allem aber sollte der Kritiker doch genau lesen können. Goethes Haltung in der Frage der Todesstrafe ist hier völlig irrelevant, weil es eben gar nicht um die Todesstrafe geht. (Die neue Literatur zum Fall der Kindsmörderin usw. hat Schings vor einiger Zeit in der FAZ besprochen.) Und nachdem MRR am Ende dahintergekommen ist, daß es sich um ein Gleichnis handelt, hätte er ja auch einmal überlegen können, worin denn das "Essen" bestand, mit dem Goethe die Welt damals beglückt hatte und worauf er sich gegen irgendeinen kleinen mrr berufen konnte. Der "Werther" z. B. - "fad"? Der junge Goethe hat viel Übermütiges geschrieben und wußte sehr wohl, was für ein toller Kerl er war.. |
Kommentar von Erich Virch, verfaßt am 25.01.2014 um 14.39 Uhr |
|
Reich-Ranicki fühlt sich von Goethes Gedicht sichtlich getroffen. Der spricht nämlich zielsicher an, daß der Kritiker sich grundsätzlich vom Tisch des Autors nährt. Und er tut dies keineswegs auf dessen Einladung hin, wie Reich-Ranicki behauptet und ausweichend erklärt, der Kritiker sei schließlich „gehalten“ zu prüfen. Wer hält „den Kritiker" dazu an? Unter Kritikern gibt es bekanntlich ebenso wie unter allen anderen Schreibern gute und schlechte. Frei nach Reich-Ranicki heißt das: "Alle Kritiker schreiben schlechte Kritiken. Die guten Kritiker unterscheiden sich von den schlechten nur dadurch, daß sie bisweilen auch gute Kritiken verfassen.“ Da sollte sich keiner ungeprüft eingeladen fühlen.
|
Kommentar von Argonaftis, verfaßt am 25.01.2014 um 14.33 Uhr |
|
Nun, wir kennen ja Reaktionen von MRR wie „dümmstes Gedicht“ auch an anderer Stelle. „Erbärmliche Qualität“ bescheinigte er Martin Walser für „Tod eines Kritikers“. Auch Mordabsichten unterstellte er damals. „Hilfe, man will mich umbringen“ tönte damals BILD aus seinem Munde meiner Erinnerung nach. Im Gleichklang bezichtigten MRR und Frank Schirrmacher Walser des Antisemitismus. Goethe Anhänger der Todesstrafe und Martin Walser mordverdächtiger Schriftsteller? Oh, mein Gott... |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.01.2014 um 13.13 Uhr |
|
In einer wiederabgedruckten Besprechung von Goethes „Rezensent“ kritisiert Reich-Ranicki dieses „dümmste Gedicht“ Goethes vom März 1774. Im Gegensatz zu Goethe ist Reich-Ranicki kein bißchen witzig, offenbar hört für ihn hier der Spaß auf. Aber entlarvt der letzte Vers „Schlagt ihn tot, den Hund! Es ist ein Rezensent“ Goethe wirklich als „Gegner der Meinungsfreiheit“ und „Anhänger der Todesstrafe“? Letzteres war er wahrscheinlich sowieso, wie damals fast jeder. Nur geht es hier nicht um Todesstrafe, sondern um Meinungsfreiheit UND Totschlagsfreiheit, sozusagen. Aber wie ernst kann Goethe seinen Mordaufruf gemeint haben, den er mit „Tausendsackerment!“ einleitet? An „Ich hatt just mein gewöhnlich Essen,/Hat sich der Kerl pumpsatt gefressen“ knüpft Reich-Ranicki ernsthafte Überlegungen, ob auf Goethes Tisch an jenem Tag vielleicht wirklich fades Essen gestanden hat. Erst dann besinnt er sich, daß das Ganze ja nur ein Gleichnis ist und es gar nicht um ein Essen geht. Ich suche immer noch nach einer Spur von Humor, die dem komischen Gegenstand gerecht würde, kann sie aber nicht finden, nur tierischen Ernst und Stumpfsinn. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.01.2014 um 05.03 Uhr |
|
In der FAZ vom 11.1.14 ist ein Text wiederabgedruckt, den Reich-Ranicki 30 Jahre früher zu Walthers „Under der linden“ geschrieben hatte. Zu gebrochen bluomen unde gras: „Walther konnte sicher sein, dass sein Publikum ihn verstehen werde. Mit gebrochenen Blumen symbolisierten die Poeten schon damals den Verlust der Jungfräulichkeit, die Defloration.“ Es ist möglich, diese Assoziation zu haben, aber nicht zwingend, weil der Dichter ja in der dritten Strophe ausdrücklich sagt, daß der Liebhaber dort aus Blumen ein Lager hergerichtet habe. Es geht also nicht um das Pflücken einer Blume wie sonst in der erotischen Dichtung. Reich-Ranicki paraphrasiert in der üblichen Weise, sagt aber nichts zum bekannten Problem mit hêre frouwe. Ungemein bezeichnend ist wieder einmal die Verdoppelung der Jungfräulichkeit, die Defloration. Wenn es noch darum ginge, mit der blumigen Etymologie zu spielen, aber das hätte er, wenn es ihm bewußt gewesen wäre, sicher ebenso unverblümt ausgesprochen. Nein, es geht wie stets darum, die facts of life möglichst drastisch beim Namen zu nennen, damit auch der Mediziner versteht, worum es sich handelt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.11.2013 um 07.43 Uhr |
|
Die FAZ (23.11.13) druckt eine Besprechung Reich-Ranickis aus der Frankfurter Anthologie ab (siehe www.faz.net); sie gilt Erich Frieds Gedicht „Logos“, einer Wortspielerei, die nicht gerade nach meinem Geschmack ist, und Reich-Ranicki spricht auch selbst vom „Kalauer“, den Fried nicht immer vermieden habe. Am Anfang und am Schluß kommt Reich-Ranicki auf sein Hauptthema: Fried sei überschätzt worden und werde „heute wohl unterschätzt“. Aus Angst, ihn zu unterschätzen, schließt er: „Zusammen mit einigen wunderbaren erotischen Gedichten werden, so will es mir scheinen, nicht wenige der Wortspiele Erich Frieds die Zeit besser überstehen als seine unzähligen politischen Gedichte. Wie auch immer: Wir sollten seiner gedenken, wie er es verdient – mit Nachsicht und mit Respekt.“ Über das Gedicht selbst erfährt man nichts. Der Interpret erwähnt nicht einmal den seltsamen Titel, der doch für jeden halbwegs Gebildeten sofort den Anfang des Johannes-Evangeliums heraufbeschwört. Aber Reich-Ranicki mutmaßt nur, Frieds „Wortgläubigkeit“ habe mit seinem „jüdischen Erbteil zu tun“. Im Grunde geht es Reich-Ranicki immer nur um sich selbst.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.09.2013 um 10.50 Uhr |
|
Zum Tod Reich-Ranickis gedenkt die FAZ auf mehreren Seiten ihres "vielleicht bedeutendsten" Mitarbeiters (das stammt jetzt mal von mir), und es ist verständlich und richtig, daß es hymnisch zugeht. Es sind auch Texte von R.-R. selbst abgedruckt. Schmunzeln mußte ich bei einem Text über Philip Roth, ursprünglich in der FAZ von 1993 erschienen: Ob er, dieser Jude und Amerikaner, dessen viele Bücher uns schon seit über dreißig Jahren erfreuen, verwundern und auch ärgern, den wir, offen gesagt, gelegentlich schon zu allen Teufeln gewünscht haben, ob er also, Philip Roth, der demnächst sechzig Jahre alt wird, ein wirklich großer Schriftsteller ist, dessen bin ich mir immer noch nicht sicher. Solcher Stellen gibt es viele, und sie fallen mir auf, weil ich die Sorge, etwas Bedeutendes für unbedeutend zu halten und umgekehrt, überhaupt nicht teile. Komisch wirkte auch über Jahrzehnte hin die immer wieder enttäuschte Erwartung, Koeppen werde vielleicht doch noch "den" großen Roman des heutigen Deutschland schreiben. (Was hätte da eigentlich drinstehen sollen, was anderswo noch niemand geschrieben hat?) Man liest nun auch wieder die ständig variierte Ansicht, Böll könne zwar nicht schreiben, sei aber trotzdem ein ganz Großer. Damit hängt vielleicht zusammen, daß Reich-Ranicki über die Sprache der Schriftsteller wenig Bestimmtes zu sagen wußte. (Über die Rechtschreibreform steht nichts in den Nachrufen, oder?) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.03.2012 um 06.53 Uhr |
|
Laut Verlagswerbung hat Tilman Krause über Walter Kappachers neues Buch gesagt, es sei "der vielleicht wichtigste Roman" des Jahres. Ein Buch kann noch so schlecht oder erfolglos oder beides sein – "wichtig" kann man es immer noch finden. Und dann auch noch "vielleicht"! Vielleicht stellt sich nach zwanzig Jahren heraus, daß es vielleicht doch nicht der wichtigste Roman war? Dann hat man trotzdem nicht zuviel gesagt. Aber was sind zwanzig Jahre ... Die Wichtigkeit stellt sich manchmal erst nach 2000 Jahren heraus. Warten wir´s also ab. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.02.2011 um 09.39 Uhr |
|
Lieber Herr Wrase, es geht mir ja nicht darum, das Wort vielleicht aus dem Verkehr zu ziehen. Ich gebrauche es selbst ziemlich oft. Was mich stört, ist die Verbindung eines maximalistischen Urteils mit dem verzagten Adverb. Um von einem polnischen Theologen sagen zu können, er sei die bedeutendste Persönlichkeit des 20. Jahrhunderts (also der bedeutendste von vielleicht (!) 15 Mrd. Menschen), muß man Gottvater selbst sein. Das ist doch der helle Wahnsinn! Und dann kriegt man kalte Füße und setzt vielleicht hinzu. Das heißt: Na ja, ich lasse mit mir reden, es mag irgendwann und irgendwo noch jemanden gegeben haben, der es mit ihm aufnehmen kann. Vielleicht ist es sein schönstes Buch. Man muß doch wissen, welches Buch von Lenz einem am besten gefällt. Was soll denn die Einschränkung überhaupt? Es klingt irgendwie nachdenklich, besonnen - und ist doch nur die abgedroschenste Phrase. (Die pseudo-objektiven Urteile Reich-Ranickis bezeugen, wie ich schon mal gesagt habe, seine seltsame Angst, etwas Bedeutendes unbedeutend, etwas Unbedeutendes bedeutend gefunden zu haben. Das durchzieht seine ganze Literaturkritik.) Natürlich kann man die "Eleganz" eines Literaturkritikers nicht exakt messen. Ich bestreite sogar, daß "Eleganz", die man ja auch Mosebach zuschreibt, eine sinnvolle Kategorie ist, außer in Modezeitschriften. Vielleicht habe ich auch schon mal so dahergeplappert, aber dann soll es von jetzt an nicht wieder vorkommen. "Elegante Literaturkritik"! Pfui Deifi! |
Kommentar von Wolfgang Wrase, verfaßt am 07.02.2011 um 00.41 Uhr |
|
Die Beifügung von "vielleicht" hat m. E. oft ihre Berechtigung. Wir können bei aller Liebe zum klaren Wort doch nicht nur eindeutige Aussagen machen. Das wären oft unangemessene Tatsachenbehauptungen oder aufdringliche, distanzlose Bekenntnisse. Reinhard Baumgart, der vielleicht eleganteste Literaturkritiker wirkt auf mich angemessen. (Ich meine damit nicht, daß das Werturteil stimmt, sondern wie es präsentiert wird.) Es ist nach meinem Empfinden eine Spur stärker als Reinhard Baumgart, ein ganz besonders eleganter Literaturkritiker, und dieses ist etwas stärker als Reinhard Baumgart, einer der elegantesten Literaturkritiker. Bei der letzteren Formulierung wird Baumgart nur als Vertreter einer Spitzengruppe dargestellt, während die beiden ersten Formulierungen allein ihn herausheben und preisen. All dies ist stärker als das platte Eigenschaftswort Reinhard Baumgart, ein eleganter Literaturkritiker und schwächer als der absolute Superlativ Reinhard Baumgart, der eleganteste Literaturkritiker. Müßte man solche Abstufungen nicht sofort erfinden, wenn es sie nicht gäbe? Gegen die Berechtigung von abgestuften Aussagen mit mehr oder weniger deutlichem Vorbehalt spricht auch nicht, daß "vielleicht" mißbraucht werden kann, um sich vor einer klaren Aussage auch dann zu drücken, wenn eine solche angebracht wäre. Ist es denn überhaupt möglich, die Eleganz eines Literaturkritikers exakt zu bestimmen? Vieles weiß man nicht genau. Dann sagt man "vielleicht". |
Kommentar von R. M., verfaßt am 06.02.2011 um 23.03 Uhr |
|
"Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), an early proponent of Romanticism, is considered one of the most influential thinkers in Western culture and perhaps the most important writer in the German language." (Harold Bloom)
|
